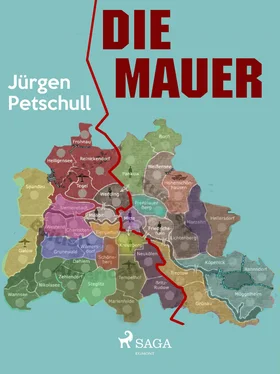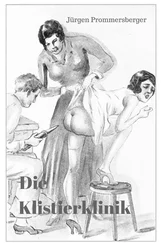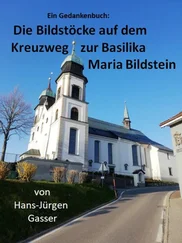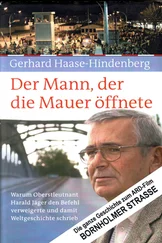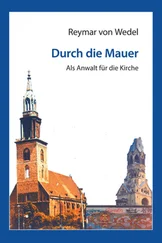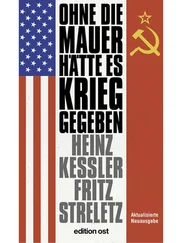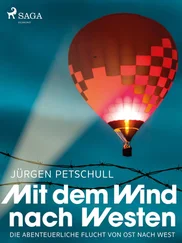In Washington, so scheint es, ist der amerikanische Präsident bis ins Detail über Berlin informiert und auf alles Denkbare vorbereitet – nur nicht auf das, was wirklich geschehen wird.
In Moskau treffen sich vom 3. bis zum 5. August 1961 die Ersten Sekretäre der „Zentralkomitees der Kommunistischen Parteien der Mitgliedsländer des Warschauer Paktes” und ihre Berater. Erst Jahre später werden im Westen Einzelheiten bekannt. Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende der DDR, ist bei dieser Zusammenkunft Angeschuldigter und Ankläger zugleich. Angeschuldigt, weil er es nicht geschafft hat, die Lebensverhältnisse in der DDR und die Umerziehung der Menschen zum Kommunismus so voranzubringen, daß sie nicht massenweise in den Westen fliehen. Seit Chruschtschows Berlin-Ultimatum vom November 58 sind in den vergangenen 20 Monaten weitere 430 000 DDR-Bewohner in die Bundesrepublik abgewandert – die meisten von ihnen wieder über Westberlin. Ulbricht seinerseits beklagt sich gegenüber Chruschtschow und den anderen im Kreml versammelten Partei-Chefs über mangelnde Solidarität. Sie hätten ihn und die DDR im Stich gelassen und die Lösung des Berlin-Problems immer weiter hinausgezögert – zum Schaden der DDR-Volkswirtschaft und zum Schaden des gesamten Kommunismus. Ulbricht fordert entschiedene Maßnahmen gegen das „Agenten- und Spionagenest Westberlin, in dem Menschenhändler und Kopfjäger labile Elemente aus der DDR abwerben”.
Einer der Konferenzteilnehmer, der Parteisekretär im Verteidigungsministerium der Tschechoslowakei, Jan Sejna, ist Jahre später in den Westen geflüchtet. Er hat gegenüber westlichen Geheimdiensten ausgepackt. Seine Aussagen sind nicht unumstritten. Der Überläufer berichtet vom Moskauer Geheimtreffen der Warschauer-Pakt-Staaten Anfang August 1961: „Ulbricht hat damals eine Übernahme von ganz Westberlin und die Kontrolle über die Luftkorridore gefordert.” Das sei abgelehnt worden, und man habe eine weniger radikale Lösung zur Unterbindung des Flüchtlingsstromes beschlossen. Sejna erzählt: „Ulbricht sagte schließlich: ‚Danke, Genosse Chruschtsschow, ohne Ihre Hilfe können wir dieses schreckliche Problem nicht lösen.’” Und Chruschtschow habe den DDR-Staatsratsvorsitzenden noch einmal in seine Grenzen verwiesen: „Ja, ich bin einverstanden – aber keinen Millimeter weiter ...!” An den Tagen nach dem Geheimtreffen der kommunistischen Regierungschefs geschehen zwischen Moskau und Ostberlin und in den beiden Teilen Deutschlands Dinge, die sich später wie Teile eines politischen Puzzles zusammenfügen lassen.
In Moskau wird die geglückte Landung des zweiten bemannten Raumschiffes „Wostok II” gefeiert. Bei einem Empfang des Kosmonauten German Titow prahlt Chruschtschow mit der technologischen Überlegenheit der Sowjetunion – er berichtet von einer neuen einsatzfähigen Superbombe mit der Sprengkraft von 900 Tonnen TNT. Am nächsten Tag beginnen gemeinsame Manöver sowjetischer und ostdeutscher Truppen in der Nähe von Berlin. Die Nationale Volksarmee wird aufgerufen, die Ausbildung „gefechtsnah zu gestalten und die Schießergebnisse zu verbessern”. Die Devise lautet: „Soldaten entscheiden durch Taten im Kampf gegen den Imperialismus.”
Am 7. August trifft Marschall Iwan S. Konjew in Ostberlin ein. Der glatzköpfige, vierschrötige Konjew ist ein gefeierter Held des Zweiten Weltkrieges und Spezialist für Städtekampf. Man nennt ihn den „Eroberer von Prag und Dresden. Er übernimmt im Auftrage von Chruschtschow den Oberbefehl der in der DDR stationierten sowjetischen Truppen. Er wird sogleich von Walter Ulbricht empfangen.
Das „Neue Deutschland”, Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), berichtet, daß in „zahlreichen Betrieben Komitees gegen den aus Westberlin betriebenen Menschenhandel und Kopfjägerei” gebildet worden sind. Die 53 000 Grenzgänger müssen sich registrieren lassen und sich verpflichten, ab Mitte September Arbeitsplätze in der DDR zu suchen. Walter Ulbricht sagt: „Wenn gewisse Leute befürchten, daß ihnen das Hintertürchen verschlossen wird, durch das sie bisher ihre Konterbande – Spionage, Sabotage und Menschenhandel – in die Deutsche Demokratische Republik einschmuggeln konnten, dann besteht diese Furcht zu recht.”
Am selben Tag berichtet die Westberliner Zeitung „BZ”: „Verzweifelte Menschen fliehen aus der Hoffnungslosigkeit.” – „Gestern kamen 2000 Flüchtlinge.” – „Es gibt in der Zone kein Halten mehr. Die Leute rennen, retten, flüchten!” – „Die ganze Zone ist von Unruhe erfüllt!”
Die Frage in diesen Tagen ist: „Wird ganz Berlin dichtgemacht?” („BZ”). DDR-Bewohner, die bisher nur mit dem Gedanken gespielt haben, vielleicht irgendwann einmal in den Westen zu gehen, packen nun hastig und unauffällig ihre sieben Sachen und fliehen durch immer stärker werdende Kontrollen aus der DDR zunächst nach Ostberlin und dann weiter mit der S-Bahn oder zu Fuß in den Westteil der Stadt. Tag für Tag werden neue Flüchtlingsrekorde gemeldet. 4. August: 1155 Flüchtlinge. – 5. August: 1283 Flüchtlinge. – Wochenende vom 7. zum 8. August: 3628 Flüchtlinge.
Am 9. August fliehen 1926 Menschen aus der DDR in den Westen. An diesem Tag trifft sich das oberste Führungsgremium der Deutschen Demokratischen Republik, das SED-Politbüro, zu einer Notstandssitzung auf dem von der Außenwelt völlig abgeschirmten Landsitz das Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Das Haus in der Schorfheide, 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, wird von einem tiefgestaffelten Sicherheitskordon von Polizei und Armee gesichert. Die schwarzen Wolga-Limousinen mit den Ministern der DDR-Regierung passieren die Kontrollen. Der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke ist dabei; Justizministerin Hilde Benjamin; der Innenminister Karl Maron und Erich Honecker, der frühere FDJ-Führer und von Ulbricht ernannte Sekretär für Nationale Sicherheitsfragen. Das einzige Thema der DDR-Machthaber: Wie kann der für die DDR zur Existenzgefährdung gewordene Strom der Republikflüchtlinge gestoppt werden. Gastgeber Walter Ulbricht informiert die Spitzengenossen von den Beschlüssen der Warschauer-Pakt-Staaten in Moskau zur „Regelung der Grenzfragen in Berlin”.
Trotz aller vergangenen Querelen und Diadochenkämpfe ist Walter Ulbricht, jetzt 68 Jahre alt, nach wie vor unumstritten der mächtigste Mann der Deutschen Demokratischen Republik. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Staatsrates und Parteichef der SED. Ulbricht, Sohn eines sächsischen Schneidermeisters und gelernter Tischler, begann seinen politischen Aufstieg 1919 als Mitbegründer der „Kommunistischen Partei Deutschlands” (KPD) in Leipzig. Er wird Mitglied des sächsischen Landtages und 1928 Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Westfalen-Süd. Von den Nazis verfolgt, leitete er nach 1933 im Untergrund die Arbeit der verbotenen KPD. Dann flüchtet er nach Brüssel, nach Paris und nach Madrid. Von 1938 bis zum Kriegsende lebt er in der Sowjetunion. Hier gründet Ulbricht das „Nationalkomitee Freies Deutschland”. Im April 1945 kam er als prominenter moskautreuer Kommunist und als Leiter der sogenannten „Gruppe Ulbricht” nach Berlin zurück. Zusammen mit Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl gründet er aus Teilen der SPD und der Kommunistischen Partei die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Von den Sowjets gefördert, wird Ulbricht 1950 Generalsekretär der Partei und 1953 Erster Sekretär des Zentralkomitees. Mit Hartnäckigkeit, Arbeitseifer und Überzeugungskraft, aber auch durch geschicktes Intrigenspiel gewinnt Ulbricht mehr Einfluß auf die DDR-Politik als der damalige Staatsratsvorsitzende Wilhelm Pieck.
Ulbricht wird zum eigentlichen Gegenspieler des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Wie Adenauer die Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten verbündet und in die westliche Verteidigungsallianz Nato integriert, so bindet Ulbricht die DDR eng an die Sowjetunion und gliedert sie in das Militärbündnis der Warschauer-Pakt-Staaten ein. Ulbricht erreicht jedoch in der DDR nie die Volkstümlichkeit, die Konrad Adenauer in der Bundesrepublik genießt. Adenauers großväterlichem Charme und seinem rheinischen Witz und seiner Verschlagenheit hat Ulbricht wenig entgegenzusetzen. Klein und gedrungen von Statur, mit Spitzbart und hoher, sächsischer Fistelstimme wird er im Westen zur Lieblingsfigur von Karikaturisten und Kabarettisten.
Читать дальше