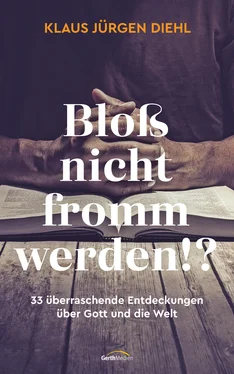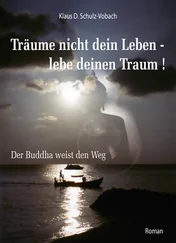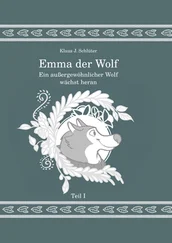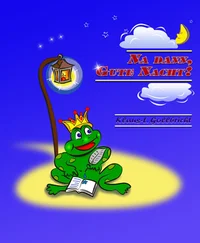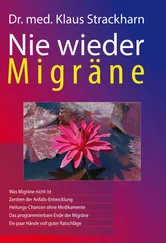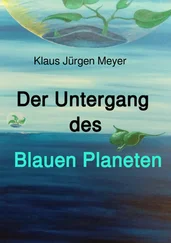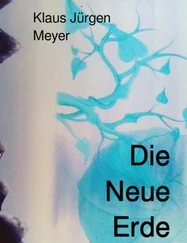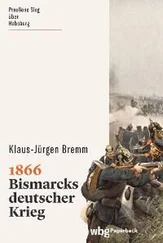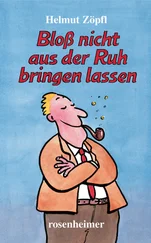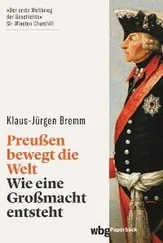Seit jeher sind Menschen darauf bedacht, die eigene Identität durch Abgrenzung von anderen sicherzustellen. Im Anderssein begründet man sein eigenes Selbstbewusstsein und fühlt sich dabei Fremden gegenüber häufig überlegen. Gerade heute breitet sich eine populistische Strömung aus, die fremde Völker und Kulturen ablehnt bzw. abwertet und aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus vor jeder Form von Gemeinsamkeit und Integration warnt. Ein sich abschottender, überlegen dünkender Nationalismus hat gegenwärtig eher Konjunktur, als z. B. in einem zusammenwachsenden Europa die Gemeinsamkeiten herauszustellen und die versöhnte Verschiedenheit mit anderen Völkern zu suchen und Solidarität zu üben. Das zeigt sich besonders angesichts des Umgangs mit den Folgen der Corona-Pandemie, die bisher weithin ein solidarisches Handeln innerhalb der EU vermissen lassen.
Israel ist als von Gott auserwähltes Volk auf Abgrenzung bedacht
Nun lässt sich auch schon im Alten Testament beobachten, dass sich das Volk Israel bewusst von anderen Völkern mit ihren Kulturen und Religionen abgrenzt. Damit Israel sich im Bewusstsein, Gottes auserwähltes Volk zu sein, nicht zu einem Gefühl exklusiver Überlegenheit verleiten lässt, macht Gott ihm klar: „Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat“ (5. Mose 7,7 f.). Allerdings scheinen Gottes Gebote eine separatistische Grundeinstellung zu bestätigen: So sollen die Israeliten keine Frauen aus fremden Völkern heiraten (2. Mose 34,16; 5. Mose 7,3) und noch viel weniger in religiöser Hinsicht gemeinsame Sache mit den heidnischen Kulten aus ihrer kanaanäischen Umwelt machen (z. B. Richter 6,25 ff.). All das ist Gott ein Gräuel. So gehören ein strenger Nationalismus und eine entschlossene Abgrenzung gegenüber den Nachbarvölkern zur Staatsraison im alten Israel. Doch dann wird dieses Bild schon im Alten Testament zunehmend erweitert bzw. korrigiert. So wird die kanaanäische Hure Rahab ausdrücklich als Retterin der jüdischen Kundschafter mit ihrer Familie verschont (Josua 2) und im Neuen Testament neben den jüdischen Patriarchen wie Abraham, Isaak und Mose sogar als Vorbild des Glaubens hingestellt (Hebräer 11,31). Der Moabiterin Ruth wird ein ganzes biblisches Buch im Alten Testament gewidmet, weil sie nach dem Tod ihres Mannes der Schwiegermutter auf ihrem Weg zurück in die jüdische Heimat folgt (Ruth 1,16 f.). Und auch Gott ist nicht ausschließlich der Gott seines auserwählten Volkes, sondern wählt heidnische Könige als sein Werkzeug aus, um seine Pläne durch sie auszuführen. So wird der persische König Kyros von Gott sogar als „mein Gesalbter“ (hebräisch „Messias“) gewürdigt, um seinen Willen zu tun, nämlich sein in der babylonischen Verbannung darbendes Volk wieder in die Heimat zurückkehren zu lassen (Jesaja 45,1 ff.). Schließlich findet sich schon im Alten Testament die religiöse und nationale Trennungen überwindende Verheißung, wonach die Heidenvölker zum Tempel nach Jerusalem wallfahrten werden, um sich zu dem Gott Israels zu bekehren und von ihm „Weisung zu empfangen“ bzw. „das Heil unseres Gottes [zu] sehen“ (Jesaja 2,1 – 4; 52,10).
Jesus lobt den Glauben von Nichtjuden
Auch im Neuen Testament sieht es zunächst so aus, als ob Jesus exklusiv der Retter Israels ist und entschieden die Erwartungen von Nichtjuden an sein Heil und seine Hilfe zurückweist: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Matthäus 15,24). Doch dann lässt er sich doch auf die flehentliche Bitte der nicht lockerlassenden kanaanäischen Mutter ein und heilt ihre kranke Tochter. Ja, er bescheinigt dieser nichtjüdischen Frau, dass ihr Glaube groß ist (Matthäus 15,28). Überhaupt fällt an der Botschaft Jesu auf, dass er immer wieder Nichtjuden als Beispiele für vorbildlichen Glauben und Handeln hinstellt: So lobt er den römischen Hauptmann, der ihn um die Heilung seines kranken Knechtes bittet, mit den Worten: „Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden!“ (Matthäus 8,10). Und in einer von Jesus erzählten Beispielgeschichte kümmert sich ein Samariter – Mitglied eines von Juden verachteten Mischvolks – um einen unter die Räuber Gefallenen, während ein jüdischer Priester und Levit achtlos an dem Verwundeten vorbeigehen. Wo fromme Juden lieber einen großen Umweg über das Jordantal in Kauf nehmen, wenn sie von Galiläa nach Jerusalem reisen, zieht Jesus durch das verhasste Samarien und sucht die Begegnung mit den Menschen dort (z. B. mit der Frau am Brunnen von Sychar in Johannes 4). Spätestens mit dem Auftrag an seine Jünger vor seiner Himmelfahrt wird deutlich, dass Jesus nicht nur der Heiland Israels, sondern der ganzen Welt ist: „Darum gehet hin und lehret alle Völker …“ (Matthäus 28,19).
Der Glaube bewirkt Einheit über Grenzen hinweg
Als die ersten Heiden zum Glauben an Jesus kommen, tun sich die Apostel zunächst schwer, sie als vollwertige Geschwister im Glauben anzunehmen. Verantwortliche Gemeindeleiter in Jerusalem wie Petrus und Jakobus vertreten zunächst die Auffassung, die bekehrten Heiden müssten erst durch Beschneidung und Befolgung der Tora zum Judentum übertreten, um dann auch Christen sein zu können. Doch dann macht Gott selbst dem Petrus durch eine Vision (Apostelgeschichte 10) und kurz darauf dem zum Apostel berufenen Paulus klar (Römer 15,16), dass auch den Heiden die Fülle des Heils gilt, ohne dass sie deswegen zuvor Juden werden müssten. So wird mit den Beschlüssen auf dem ersten Apostelkonzil in Jerusalem (Apostelgeschichte 15) der Grundstein für die weltweite Ökumene gelegt: Gottes Geist sorgt dafür, dass nationale, religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Grenzen überwunden und Menschen aus unterschiedlichen Völkern und Rassen sowie verschiedener sozialer Herkunft und Bildung im Glauben an Jesus beglückende Einheit erleben. Die neue Identität, die Christen als Gottes Kinder durch den Glauben verliehen wird, braucht keine Abgrenzung mehr, sondern sie sucht das Verbindende. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“, schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Galatien (Gal. 3,28). Weil das so ist, sollten Christen sich heute nicht an nationalistischen oder gar rassistischen Parolen beteiligen oder auf Abschottung gegenüber Flüchtlingen oder Fremden bedacht sein, selbst wenn diese unseren christlichen Glauben (noch) nicht teilen. Sie sollten sich schon heute durch Gastfreundschaft und Anteilnahme an ihrem Schicksal darin einüben, dass einmal an der großen Festtafel in Gottes vollendetem Reich ein buntes Völker- und Rassengemisch gemeinsam Platz nehmen und miteinander ihren Schöpfer und Erlöser loben wird. Ein für weiße deutsche Christen ohne Migrationshintergrund reserviertes Separee ist da nicht vorgesehen.
7.
GNADE KANN MAN SICH NUR SCHENKEN LASSEN
In wohl allen Religionen sind die Gläubigen zum Befolgen göttlicher Gebote und zu guten Taten verpflichtet, um das Wohlgefallen ihres Gottes bzw. der Götter zu erlangen. Den Menschen werden umfangreiche religiöse, zeremonielle und moralische Pflichten auferlegt, die sie zu erfüllen haben, wenn sie nicht den Zorn oder das Gericht Gottes auf sich laden wollen. Dabei wird nicht nur eine äußerliche Pflichterfüllung erwartet, sondern zugleich auch persönliche Opferbereitschaft. Allerdings schleicht sich dabei in die Beziehung des Gläubigen zu Gott häufig unversehens ein geschäftsmäßiges Leistungsdenken ein: Indem sich der Gläubige den von ihm geforderten Pflichten unterwirft und sie konsequent zu erfüllen sucht, verbindet er damit insgeheim oder offen die Erwartung, dass Gott ihm im Gegenzug seine Unterstützung und Hilfe gewährt. In der römischen Antike wurde diese Einstellung im Blick auf das Verhältnis zu den Göttern auf die lateinische Formel gebracht: „Do ut des“, das heißt: „Ich gebe (den Göttern) etwas, damit sie mir etwas zurückgeben“. Wenn man so will, wird auf diese Weise die religiöse Praxis zu einem Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber kann das eine angemessene Weise der Beziehung des Menschen zum Gott der Bibel sein? Wird Frömmigkeit damit nicht zu einem berechnenden religiösen Leistungssport?
Читать дальше