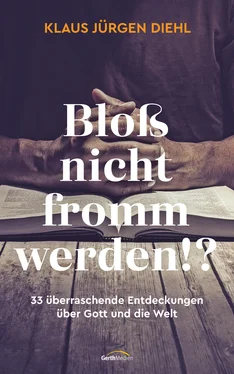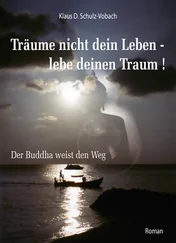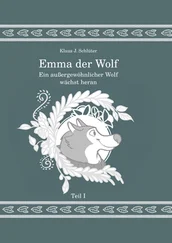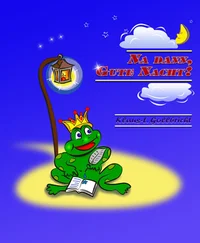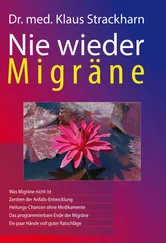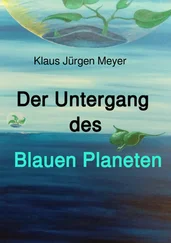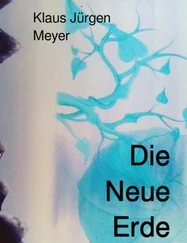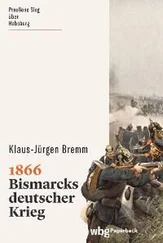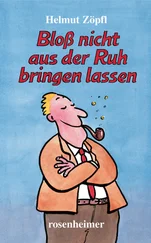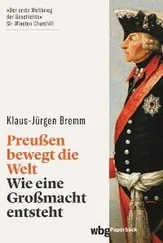5. Das Größere sehen, statt sich mit dem Sichtbaren abzufinden 5. DAS GRÖSSERE SEHEN, STATT SICH MIT DEM SICHTBAREN ABZUFINDEN Aufklärung und Rationalismus haben dafür gesorgt, dass der Himmel gründlich leergefegt und die sichtbare, materielle Welt zur einzigen Wirklichkeit erklärt wurde. „Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen!“, höhnte einst Heinrich Heine (1797–1856). Der Kirche wurde – teilweise nicht unberechtigt – der Vorwurf gemacht, dass sie die Menschen im „irdischen Jammertale mit dem Ausblick auf ein besseres Jenseits vertröste“, statt sich beherzt ihrer vielfältigen irdischen Nöte anzunehmen. Heute dagegen werden die Menschen nicht aufs Jenseits vertröstet, sondern mit dem Diesseits abgespeist. Für immer mehr Zeitgenossen ist es ausgemacht, dass mit dem Tode alles aus ist und droben „überm Sternenzelt“ eben kein „lieber Vater wohnen muss“ (Friedrich Schiller, 1757–1805). Die Frage ist nur, ob sich der Mensch auf die Dauer mit der sichtbaren Welt abfindet, oder ob sich seine Sehnsucht nach Transzendenz und Ewigkeit als stärker erweist, weil er nun einmal „unheilbar religiös“ (Joachim Fest) ist. So äußerte der marxistische Soziologe Max Horkheimer (1895–1973) in einem als Taschenbuch veröffentlichten Interview über die bleibende Bedeutung der Religion: „Sie kann dem Menschen bewusst machen, dass er ein endliches Wesen ist, dass er leiden und sterben muss; dass aber über dem Leid und dem Tod die Sehnsucht steht, dieses irdische Dasein möge nicht absolut, nicht das Letzte sein“ (aus: „Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen“).
6. Trennendes überwinden und Einheit erleben 6. TRENNENDES ÜBERWINDEN UND EINHEIT ERLEBEN Seit jeher sind Menschen darauf bedacht, die eigene Identität durch Abgrenzung von anderen sicherzustellen. Im Anderssein begründet man sein eigenes Selbstbewusstsein und fühlt sich dabei Fremden gegenüber häufig überlegen. Gerade heute breitet sich eine populistische Strömung aus, die fremde Völker und Kulturen ablehnt bzw. abwertet und aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus vor jeder Form von Gemeinsamkeit und Integration warnt. Ein sich abschottender, überlegen dünkender Nationalismus hat gegenwärtig eher Konjunktur, als z. B. in einem zusammenwachsenden Europa die Gemeinsamkeiten herauszustellen und die versöhnte Verschiedenheit mit anderen Völkern zu suchen und Solidarität zu üben. Das zeigt sich besonders angesichts des Umgangs mit den Folgen der Corona-Pandemie, die bisher weithin ein solidarisches Handeln innerhalb der EU vermissen lassen.
7. Gnade kann man sich nur schenken lassen 7. GNADE KANN MAN SICH NUR SCHENKEN LASSEN In wohl allen Religionen sind die Gläubigen zum Befolgen göttlicher Gebote und zu guten Taten verpflichtet, um das Wohlgefallen ihres Gottes bzw. der Götter zu erlangen. Den Menschen werden umfangreiche religiöse, zeremonielle und moralische Pflichten auferlegt, die sie zu erfüllen haben, wenn sie nicht den Zorn oder das Gericht Gottes auf sich laden wollen. Dabei wird nicht nur eine äußerliche Pflichterfüllung erwartet, sondern zugleich auch persönliche Opferbereitschaft. Allerdings schleicht sich dabei in die Beziehung des Gläubigen zu Gott häufig unversehens ein geschäftsmäßiges Leistungsdenken ein: Indem sich der Gläubige den von ihm geforderten Pflichten unterwirft und sie konsequent zu erfüllen sucht, verbindet er damit insgeheim oder offen die Erwartung, dass Gott ihm im Gegenzug seine Unterstützung und Hilfe gewährt. In der römischen Antike wurde diese Einstellung im Blick auf das Verhältnis zu den Göttern auf die lateinische Formel gebracht: „Do ut des“, das heißt: „Ich gebe (den Göttern) etwas, damit sie mir etwas zurückgeben“. Wenn man so will, wird auf diese Weise die religiöse Praxis zu einem Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber kann das eine angemessene Weise der Beziehung des Menschen zum Gott der Bibel sein? Wird Frömmigkeit damit nicht zu einem berechnenden religiösen Leistungssport?
8. Gott hat abgerüstet 8. GOTT HAT ABGERÜSTET Kritiker werfen der Bibel vor, dass sie voller Brutalität und Gewalt stecke und Gott vor allem im Alten Testament häufig wie ein gewalttätiger Despot handle. Ein Forscher will in der Bibel allein tausend Stellen gefunden haben, die von göttlicher Gewalt berichten. Diese Zahl scheint mir bei weitem zu hoch gegriffen. Vermutlich hat er dabei alle Bibelzitate mitgerechnet, die von Gottes (All-)Macht sprechen. Es ist aber nicht zu bestreiten, dass etliche Passagen in der Bibel ein gewalttätiges Handeln Gottes widerspiegeln. So werden in der Sintflut bis auf Noah und seine Familie sämtliche Menschen und nahezu alle Tiere vernichtet (1. Mose 7,21 f.). Über die sündigen Städte Sodom und Gomorra lässt Gott Feuer und Schwefel regnen und tötet so ihre Bewohner (1. Mose 19,24 f.). Die Streitmacht des Pharaos lässt er bei der Verfolgung der geflohenen Israeliten mit Mann und Maus im Schilfmeer versinken (2. Mose 14,27 f.). Und bei der Eroberung Kanaans befiehlt er die vollständige Ausrottung fremder Nachbarvölker, wobei selbst Frauen und Kinder nicht verschont werden sollen (4. Mose 31,14 – 17). Die Beispiele ließen sich fortsetzen und werfen die Frage auf: Ist der Gott der Bibel ein „Gott des Gemetzels“, vor dessen willkürlichem Vernichtungszorn niemand sicher ist – selbst die Israeliten nicht? Es fällt uns Heutigen schwer, diese biblischen Gewaltgeschichten mit dem Gott der Liebe und Barmherzigkeit in Einklang zu bringen, wie ihn uns Jesus auf so eindrückliche Weise offenbart hat. Es gibt eben, wie Luther erkannt hat, den verborgenen Gott, dessen Wesen und Handeln wir nicht ergründen können, sondern nur in ehrfurchtsvollem Respekt anbeten sollen. Aber wie Kinder in ihrer Angst sich an den Rockzipfel der Mutter klammern, sollen wir vom verborgenen Gott voller Vertrauen zu dem offenbarten Gott hin fliehen, der uns in Jesus mit seiner bedingungslosen Liebe überschüttet. Weil Gott der heilige und zugleich gerechte und barmherzige Gott ist, vertraue ich darauf, dass auch sein gewalttätiges Handeln nicht blinder Willkür entspringt, sondern zu der damaligen Zeit ein unübersehbares Zeichen seiner einzigartigen Macht und Souveränität aufrichten sollte.
9. Alle Tage Sonnenschein ist nicht versprochen
10. Ist die Bibel sexualfeindlich?
11. Gott loben – nicht nur in erhebenden Momenten
12. Die Letzten werden die Ersten sein
13. Gott arbeitet mit lauter Versagern
14. Ohne Umkehr zum Schöpfer verdorrt die Erde
15. Keiner wird Gott los
16. Ist unser Leben von Gott vorherbestimmt?
17. Passion contra Aktion – wer oder was rettet die Welt?
18. Gehorsam und Vertrauen bedingen einander
19. Bloß nicht fromm werden!?
20. Seine Seele stillen
21. Macht der Glaube glücklich?
22. Engel sind Boten Gottes – nicht mehr und nicht weniger
23. Jesus als genialer Geschichtenerzähler
24. Zu Gott umkehren
25. Hat Gott Humor?
26. Begrenzte Loyalität
27. Eine Chance für den Zweifler
28. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein
29. Vom Umgang mit Geld und Gut
30. Jedes Wort zählt
31. Ist Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden?
32. Muss man an den Teufel glauben?
33. Kommen am Ende alle in den Himmel?
Bei einer abendlichen Talkrunde im Deutschen Fernsehen fiel der Satz: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!“ Einer der Talkgäste bemerkte: „Das ist ja ein interessantes Zitat. Wer hat es gesagt?“ Darauf ein anderer Gast: „Das muss von Bert Brecht sein!“ Niemand in der Runde der prominenten Gäste kam auf den Gedanken, dass der Satz aus der Bibel stammt und bei Jesus noch eine Fortsetzung hat: »… sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht“ (Matthäus 4,4 im Anschluss an 5. Mose 8,3). Diese kleine Szene scheint mir symptomatisch zu sein. Das Wissen um die Botschaft der Bibel und die Grundlagen des christlichen Glaubens nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr ab. Dafür nehmen Vorbehalte und Vorurteile zu: Dieses alte Bibelbuch scheint nicht mehr in unsere Zeit zu passen; man kann sich seine Lektüre sparen, ohne dabei auf wesentliche Erkenntnisse und Einsichten für sein Leben verzichten zu müssen. Wer dagegen in unserer Zeit fromm sein möchte, der löst mit einem solchen Wunsch heftige Abwehrreaktionen aus: „Alles, bloß nicht fromm werden!“ Denn Frömmigkeit scheint nichts anderes als eine verkappte Form religiöser Selbstgerechtigkeit und Heuchelei zu sein. Mit dem vorliegenden Buch möchte ich solchen negativen Einschätzungen, einem sich immer stärker ausbreitenden Nichtwissen, aber auch berechtigten Einwänden gegenüber Bibel und Glauben begegnen. Ich möchte noch einmal genauer hinschauen, was die Bibel zu den einzelnen Themen sagt. Es ist mein Wunsch, dass Leser dabei neue, vielleicht auch überraschende Einsichten über Gott und die Welt gewinnen und zur eigenen Bibellektüre angeregt werden. Und vermutlich werden auch mit der Bibel vertraute Leser hier und da noch ungewohnt Neues entdecken können und dadurch ihren Glaubenshorizont erweitern.
Читать дальше