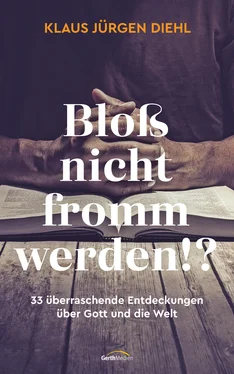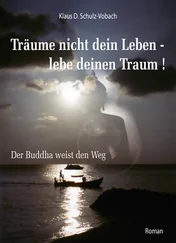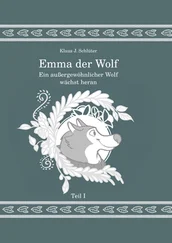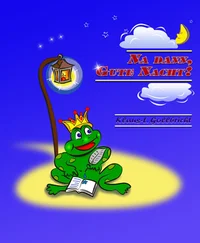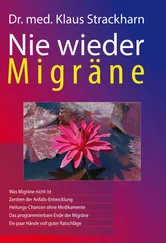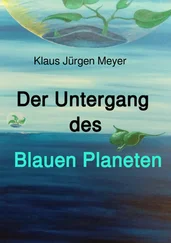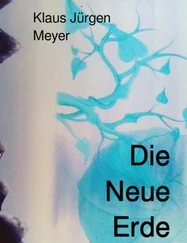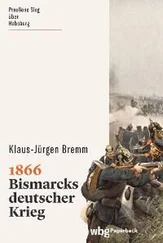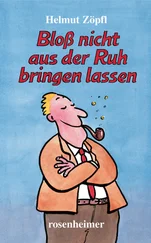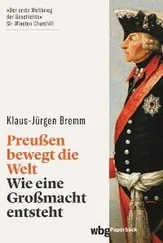Hiobs verzweifelte Klage gegen Gott
Scheint Hiob anfangs das ihm zugestoßene Leid noch getrost aus Gottes Hand zu nehmen – „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt!“ (Hiob 1,21 b) –, so wird sein Gebet zu Gott mit zunehmender Dauer seines Leids immer ungeduldiger, und er hält ihm vor, ihn zum wehrlosen Opfer seiner Anschläge gemacht zu haben: „Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Hab ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin?“ (Hiob 7,19 f.). Darf man so herausfordernd mit Gott reden, ihn geradezu anklagen? Ja, man darf, denn am Ende des Hiobbuches bescheinigt Gott Hiob, dass er im Unterschied zu den vor Frömmigkeit triefenden Reden seiner Freunde „recht von mir geredet hat“ (Hiob 42,7). Damit bestätigt Gott ausdrücklich, dass wir uns mit aufrichtigem Herzen radikal klagend an ihn wenden dürfen, wenn uns unverstandenes eigenes oder fremdes Leid zu schaffen macht.
Eine Klage und ein Vorwurf, die uns den Atem stocken lassen
Auch im Buch des Propheten Jeremia finden sich Klagen gegen Gott, die einem beim Lesen geradezu den Atem stocken lassen. Gott hat Jeremia als jungen Mann zum Propheten berufen, der einem unbußfertigen Volk über viele Jahre hinweg immer wieder das Gericht Gottes anzukündigen hat. Doch je länge diese Aufgabe dauert, umso mehr droht Jeremia, daran zu zerbrechen. So schleudert er voller Verzweiflung seine Klagen heraus, indem er Gott vorwirft, ihn in seiner jugendlichen Unerfahrenheit zu diesem unzumutbaren Amt überredet zu haben: „Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich“. Und weiter: „Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach verbringe?“ (Jeremia 20,7 und 18). Solche Klage gehört sicher zu dem Äußersten, was man im Blick auf das Gespräch eines Menschen mit Gott in der Bibel finden kann. Und doch weist auch in diesem Fall Gott seinen Propheten nicht zurecht: „Was unterstehst du dich, so mit mir zu reden?“, sondern antwortet auf dessen verzweifelte Klagen damit, dass er ihm angesichts der andauernden Anfeindungen immer wieder seinen Beistand zusagt und ihm Menschen wie den Schreiber Baruch zur Seite stellt, die zu hilfreichen Gefährten in seiner Not werden.
Wenn gelegentlich aus dem Munde gläubiger Christen der Satz zu hören ist, man dürfe doch vor Gott nicht klagen, sondern ihn allenfalls bitten, so lehrt uns die Bibel etwas anderes. Darum möchte ich gerne an dieser Stelle ein Lob auf die Klage anstimmen! Leider gibt es heute viel zu viele Menschen, die sich zwar noch über Gott beklagen, aber nicht mehr im Entferntesten auf den Gedanken kommen, sich mit ihren Klagen direkt an Gott zu wenden und ihr Herz vor ihm auszuschütten. Von dem Schweizer Hochschulevangelisten Hans Bürki (1925–2002) hörte ich vor Jahren den Satz: „Wer aufhört, Gott zu klagen, der fängt an, sich über Gott zu beklagen – und endet womöglich kläglich!“
5.
DAS GRÖSSERE SEHEN, STATT SICH MIT DEM SICHTBAREN ABZUFINDEN
Aufklärung und Rationalismus haben dafür gesorgt, dass der Himmel gründlich leergefegt und die sichtbare, materielle Welt zur einzigen Wirklichkeit erklärt wurde. „Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen!“, höhnte einst Heinrich Heine (1797–1856). Der Kirche wurde – teilweise nicht unberechtigt – der Vorwurf gemacht, dass sie die Menschen im „irdischen Jammertale mit dem Ausblick auf ein besseres Jenseits vertröste“, statt sich beherzt ihrer vielfältigen irdischen Nöte anzunehmen. Heute dagegen werden die Menschen nicht aufs Jenseits vertröstet, sondern mit dem Diesseits abgespeist. Für immer mehr Zeitgenossen ist es ausgemacht, dass mit dem Tode alles aus ist und droben „überm Sternenzelt“ eben kein „lieber Vater wohnen muss“ (Friedrich Schiller, 1757–1805). Die Frage ist nur, ob sich der Mensch auf die Dauer mit der sichtbaren Welt abfindet, oder ob sich seine Sehnsucht nach Transzendenz und Ewigkeit als stärker erweist, weil er nun einmal „unheilbar religiös“ (Joachim Fest) ist. So äußerte der marxistische Soziologe Max Horkheimer (1895–1973) in einem als Taschenbuch veröffentlichten Interview über die bleibende Bedeutung der Religion: „Sie kann dem Menschen bewusst machen, dass er ein endliches Wesen ist, dass er leiden und sterben muss; dass aber über dem Leid und dem Tod die Sehnsucht steht, dieses irdische Dasein möge nicht absolut, nicht das Letzte sein“ (aus: „Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen“).
Jesus verspricht den Ausblick auf Gottes Reich
Die Bibel gibt uns auf vielfältige Weise eine Antwort auf diese Sehnsucht. Sie öffnet uns die Augen dafür, dass mit Jesus der Himmel auf die Erde gekommen ist und hebt uns aus einer sehr begrenzten, eingeengten Froschperspektive empor zum Überblick eines Adlers, dem sich ein weiter, bisher ungeahnter Horizont eröffnet. Als Nathanael, ein kritischer junger Mann, zum ersten Mal Jesus begegnet, ist er voller Zweifel und Skepsis, ob dieser Wanderprediger wirklich der verheißene Messias für Israel ist. Er fragt sich: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“ (Johannes 1,46). Im Klartext: Wie soll ein Mann aus einem so unbedeutenden Nest wie Nazareth den Durchblick haben und die Hoffnung Israels auf den Messias erfüllen können? Doch dann macht Jesus ihm schon bei der ersten Begegnung klar, dass er sich in seinem Leben auskennt und ihn bis ins Innerste durchschaut hat. In diesem Augenblick fällt die ganze Skepsis des jungen Mannes wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Er fällt Jesus zu Füßen und bekennt: „Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel“ (Vers 49). Doch mit der umwerfenden Erfahrung, dass Jesus den Durchblick im Leben des Nathanael hat, ist die Geschichte nicht zu Ende. Vielmehr verspricht Jesus dem jungen Mann den Ausblick auf die Weite des Reiches Gottes: „Du wirst noch Größeres sehen als das!“, und er erinnert ihn und die umstehenden Jünger an den Traum Jakobs von der Himmelsleiter (1. Mose 28,10 ff.): „Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn“ (Verse 50 – 51). Damit macht er klar: „Ihr müsst nicht länger unter einem verschlossenen Himmel leben. Der Himmel ist auch nicht leer, sondern mit mir ist der Himmel auf die Erde gekommen. Gott hält seine ganze Herrlichkeit für euch bereit.“
Die Ewigkeit rückt unsere Perspektiven zurecht
Spätestens seit Jesus Mensch wurde, müssen wir uns nicht mehr mit der sichtbaren Welt als letzter und einziger Wirklichkeit abfinden. Trotz der Begrenztheit unseres irdischen Lebens steht für uns eine ganze Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott bereit. Das Tor zu dieser Ewigkeit hat Jesus durch sein Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen für immer weit aufgestoßen. Die Perspektiven unseres irdischen Lebens werden damit zurechtgerückt und bewahren uns im Alltag vor Kurzsichtigkeit und Kurzatmigkeit. Das kann eine weitere überraschende Entdeckung im Buch der Bücher sein. Durch den Ausblick auf die Ewigkeit tut sich für uns ein bisher ungeahnter oder vergessener Horizont auf. Mit Marie Schmalenbach (1835–1924), der Pfarrfrau aus Mennighüffen in Ostwestfalen, bitten wir: „Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Sel’ge Ewigkeit!“
6.
TRENNENDES ÜBERWINDEN UND EINHEIT ERLEBEN
Читать дальше