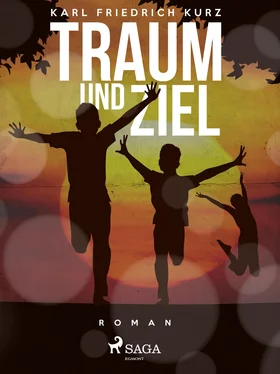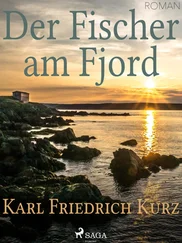Dazu seufzten die Frauen; sie trauten wohl Hannes Franks Künsten nicht recht. Weil jedoch kein Geld für Arzt und Apotheker vorhanden war, wussten sie keinen besseren Rat. Gott müsse nun weiter sorgen, dachten die Frauen bei sich selber und glaubten an die höhere Fügung.
Konrad, das Opfer, zeigte sich zufrieden mit der Behandlung und allem; still blickte er zum Fenster hinaus, träumte den Wolken nach, folgte dem Flug der kleinen Vögel, sah die stolzen Tannenwipfel sich im Winde zierlich zueinander neigen, erwartete des Abends die funkelnden Sterne. Sobald er mit Werner allein war, begann er von dem feinen Mädchen Alma zu sprechen, von kleinen, unschuldigen Begebenheiten. In der langen Ruhe des Krankenlagers stieg in seiner Erinnerung alles Erlebte empor, wuchs und leuchtete und überstrahlte das Leid. Er sprach von seinem Tod mit gleichmütiger Selbstverständlichkeit, als liege das noch in unbestimmter Ferne. In kindlicher und schauerlicher Weise verband er unaufhörlich beides, seine Liebe und sein Sterben.
Ruhig, eintönig flossen die Tage dahin. Der Winter kam. Die Menschen im Ritterhof drängten sich enger zusammen in der warmen Stube. Vor den Fenstern gingen finstere Schatten um. Aber die Menschen fühlten sich geborgen für die Nacht, für den nächsten Tag. Menschen, die in Armut leben, wagen selten, lange vorauszudenken.
Es richtete jedoch das Schicksal, das erbarmungslose, gerade auf diese paar Menschen ein scharfes Auge und wollte ihnen keine Ruhe gönnen. Das Schicksal hakte seinen Finger in die Stelle, die für die Lohmanns seit jeher am schwächsten war. Unerwartet versagte der Drogist dem verunglückten Lehrling die weitere Unterstützung.
Ach, dieser biedere Mann, niemand kann ihn deswegen tadeln, ihn selber zwang die harte Notwendigkeit. Da er keine Güter besass, blieb ihm nichts, womit er Konrad hätte helfen können.
Elisa verstand das nicht, als sie am Ende der Woche das Geld abholen wollte. Nein, sie begriff durchaus nichts, obschon der Drogist es mit klaren Worten sagte. „Mein liebes Fräulein, dieses ist nun leider mein letztes Geld“, sagte er. „Wie gern möchte ich helfen bis zum Ende. Doch euer Konrad scheint ja immer weiter und weiter zu leben. Und dieses kann ich nicht aushalten.“
„Wieso?“ fragte Elisa empört. „Dass Ihnen Ihre Lästerzunge verdorre! Er lebt Ihnen zu lange?“
„Ich verstehe Ihren Zorn und würdige ihn“, entgegnete darauf der Drogist. „Aber Sie müssen auch mich verstehen. Hier gebe ich Ihnen also mein letztes Geld. Ich habe nicht einmal den Lohn für meinen Gehilfen. Ausserdem besitze ich eine Frau und vier Kinder; aber kein anderes Vermögen; das Geschäft hier gehört eigentlich meinen Gläubigern. Seit dem Unfall muss ich noch mehr Schulden machen. Und weil ich ja nur ein kleiner Krämer bin, stehe ich nicht in der Unfallkasse. Niemand hilft mir.“
Ja, so standen hier die Dinge. Elend stand neben Elend. Aber Elisa begriff das immer noch nicht. Sie erklärte: „Wenn wir kein Geld mehr bekommen, müssen wir verhungern.“ Und das war vielleicht keine grosse Übertreibung, sondern nur der gewöhnliche Weltlauf.
Der Drogist erwiderte: „Und wenn ich euch noch mehr gebe, muss ich selber verhungern. Damit wäre euch nicht geholfen — oder?“
„Sie sind der Satan in Person!“ rief Elisa.
„Leider nicht“, widersprach der Drogist. „Sonst hätte ich andere Kräfte, und ich könnte euch und mir selber helfen.“
Sie unterhielten sich noch eingehend über diese verwickelte Angelegenheit. Worte ohne Wert und Sinn, unnütze Kraftvergeudung. Konrads allerletzter Verdienst versiegte.
Zu allem Überfluss ereignete sich im Laufe der folgenden Woche auch noch dieses: Hannes Frank kehrte vom Dienst zurück und war zum erstenmal nicht selbstsicher und kühn, sondern im Gegenteil ausserordentlich zahm und fromm. Irgend etwas musste da vorgefallen sein, beim Manövrieren mit den Eisenbahnwagen. Möglicherweise eine falsche Weichenstellung oder ein falsches Signal. Möglicherweise pfiff Hannes Frank, der Obmann, ein paar Sekunden zu früh oder zu spät auf seiner Trillerpfeife. Der Möglichkeiten gibt es unzählige, wenn etwas geschehen soll. Hier endete es mit einem Zusammenstoss und einer Entgleisung mit ein paar verwundeten Menschen und beträchtlichem Sachschaden.
„Ich bin nicht schuld daran“, brüllte Hannes Frank in der herrschaftlichen Küche des Ritterhofs. Hannes Frank fand leicht die Schuld hier und dort und stets bei anderen.
Aufgeklärt wurde der Vorfall nicht. Vielleicht machten sie aus Hannes Frank den erforderlichen Sündenbock. So oder so — entlassen war er. Knall und Fall.
Es ging lebhaft zu in der Küche. Hannes Frank bekam einen Wutausbruch und fluchte grässlich.
„Was soll nun aus uns allen werden?“ jammerten die Frauen.
Hannes Frank schwor und heulte, warf seine Trillerpfeife zum Fenster hinaus und schrie: „Fahr zur Hölle!“ Die Mütze mit dem glänzenden Schild warf er auf den Marmorboden der herrschaftlichen Küche und zertrampelte sie mit seinen Plattfüssen.
Auf einem verzwickten Umwege geriet er dadurch mit seiner mündigen Schwägerin Elisa in den prächtigsten Streit, der zwar mit seiner Entlassung in keinem Zusammenhang stand, ihn jedoch vom eigenen Missgeschick ablenkte. Alles miteinander bedeutete das unrühmliche Ende von Hannes Franks Staatsdienst.
Zur Stunde, da in der Küche der Kampf gewaltig tobte, unterhielten sich auf der anderen Seite des grossen Hauses zwei Knaben über das Wunder der Liebe. In Wirklichkeit befanden sich drei Personen im Zimmer. Werner sass auf seinem Stuhl, Konrad lag in seinem Bett, und die Puppe stand auf der Decke. Die Puppe lehnte sich gegen den weissen Verbandhügel, ja sie stützte gefallsüchtig ihre Hand auf Konrads verwundeten Arm, lächelte mit ihrem himbeerroten Mund und starrte mit ihren Glasaugen hochmütig und kalt ins Leere.
Wenn die Knaben schwiegen, drang das Getöse aus der Küche schauerlich bis in die Stube. Aber das störte sie nicht. Konrad drehte seinen Kopf dem Fenster zu und seufzte: „Ich hätte so ungeheure Lust, ihr einen Brief zu schreiben.“
Das schien Werner ein vorzüglicher Gedanke. „Ja, gewiss musst du ihr schreiben“, sagte er eifrig.
„Aber das ist nicht so einfach, wie du dir wohl vorstellst. Denn vergiss nicht, dass es sich doch um eine richtige Dame handelt.“
„Ho — was nun dieses anbetrifft. Wir beide kennen sie doch schon lange. Wir kennen sie von der Zeit her, als sie noch mit Hängezöpfen zur Schule ging.“
„Das hat hier nicht das geringste zu bedeuten. Sobald ein vornehmes Mädchen sechzehn oder siebzehn Jahre alt wird, ist es eben eine Dame, verstehst du?“
„So? Meinetwegen! Mag sie eine Dame sein — schreiben darfst du ihr dennoch.“
„Das fragt sich sehr. Und ich weiss wirklich nicht, ob ich es wagen soll. Ein Brief an sie — ich kann es mir gar nicht vorstellen.“
„Weshalb solltest du nicht schreiben dürfen? Hast du ihr denn nicht den schönen Hut gerettet und nicht einmal Geld dafür genommen?“
Konrad bleibt trotzdem bedenklich. „Darauf kommt es heute längst nicht mehr an. Aber vielleicht, wenn ich ihr sagen würde, dass ich ihr nie mehr auf der Strasse begegnen werde und sie sich meinetwegen nicht zu schämen braucht, wird sie es mir nicht übelnehmen, sondern mir verzeihen. Denn es bleibt, das darfst du ruhig glauben, eine riesige Frechheit. Ja, das weiss ich doch.“
„Eine Frechheit? Wie sollte es sie beleidigen? Soviel muss sie doch verstehen.“
Schon holt Werner Papier und Bleistift. „Zuerst wollen wir den Brief dichten. Dann schreibe ich ihn auf mein schönstes Papier. Und wenn du willst, schreibe ich ihn mit roter Tinte.“
„Nein“, lächelt Konrad. „Was fällt dir ein? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen.“
„Also los! Ich schreibe: Liebste Alma ...“
Читать дальше