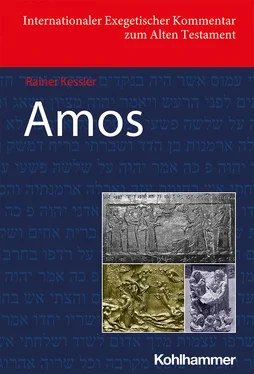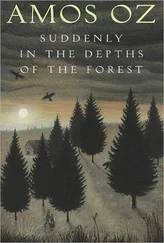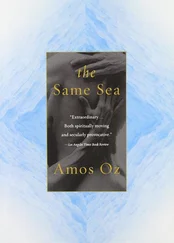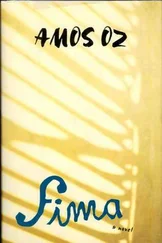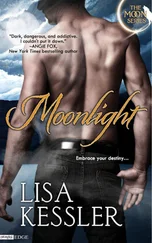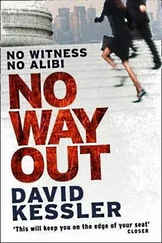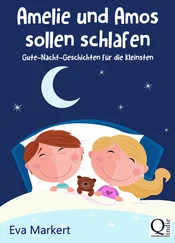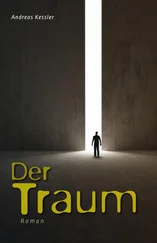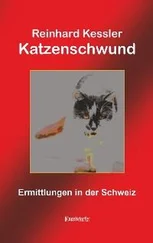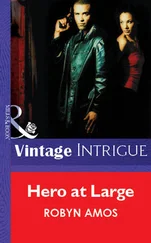1,12In der Androhung von V. 12 steht an erster Stelle Teman, gegen das Jhwh Feuer schickt, dessen Ziel die Paläste Bozras sind. Auch wenn Teman eigentlich eine Teilgröße von Edom ist (Gen 36,11.15.34.42; Ez 25,13; 1 Chr 1,36.45.53), wird es hier pars pro toto für Edom als Ganzes gebraucht (vgl. Jer 49,7; Ob 9). Ähnlich verhält es sich mit Bozra. Es ist eine unter mehreren Städten in Edom (Gen 36,33 = 1 Chr 1,44), die aber, wenn sie im ausschließlichen Parallelismus von Edom par. Bozra gebraucht (Jes 34,6; 63,1; Jer 49,22) oder als einzige Stadt Edoms genannt (Jer 49,13) wird, als dessen Hauptstadt gilt. Festzuhalten ist, dass auch in dieser wie in allen Strophen mit den Palästen die Wohnstätten der Herrschenden Ziel des göttlichen Eingreifens sind.
1,13Mit der Ammoniterstrophe beginnt ein weiteres Paar von Langstrophen. Die Ammoniter, die östlich von Jordan und Totem Meer leben (in der heutigen jordanischen Hauptstadt Amman ist ihr Name erhalten), grenzen südlich an das ostjordanische Gilead an, dessen nördlicher Nachbar der Aramäerstaat von Damaskus ist. Das ihnen vorgeworfene Verbrechen richtet sich wie das der Damaskusstrophe gegen Gilead. Der Vorwurf umfasst zwei Aspekte: die Grausamkeit der Kriegsführung und das Ziel der territorialen Erweiterung. Dass die Ausdehnung des eigenen Herrschaftsgebiets ein vorrangiges Kriegsziel der meisten damaligen Kriege war, geht aus zahlreichen Texten des Alten Testaments wie auch der Nachbarn Israels und Judas, etwa der Mescha-Stele, hervor. Das macht es auch unmöglich, das in Am 1,13–15 angesprochene Ereignis historisch einzugrenzen. Das Aufschlitzen der Bäuche schwangerer Frauen, um Mutter und Kind zu töten, wird immer wieder genannt. In 2 Kön 8,12 wird es als Vorwurf gegen Hasael von Damaskus erhoben. Es wird hier als verwerfliches Kriegsverbrechen angeklagt.
Gleichwohl hat selbst dieser Zug einer in unseren Augen barbarischen Kriegsführung einen ambivalenten Charakter. Denn in einem sogenannten Heldenlied wird ein ungenannter assyrischer Herrscher, wahrscheinlich Tiglatpileser I. (1114–1067 v. Chr.), dafür gerühmt, dass er solche Grausamkeiten begeht: „Er zerfetzte das Innere der Schwangeren, durchbohrte die Schwachen. Ihren Mächtigen schnitt er die Hälse ab.“ “He slits the wombs of pregnant women; he blinds the infants; / He cuts the throats of their strong ones.” 46Wie bei den Vorwürfen gegen Aramäer und Philister kommt es darauf an, aus welchem Blickwinkel man das Geschehen betrachtet. Kriegsgräuel erscheinen sowohl als Klage der Unterlegenen als auch als Selbstruhm der Sieger.
Wird die Härte der Kriegsführung wie hier aus der Perspektive der Opfer heraus kritisiert, tritt ein Effekt ein, den wir schon bei der Damaskusstrophe beobachten konnten. Dort wurde den Aramäern vorgeworfen, dass „sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen“ hätten (V. 3). Wenn solches „Dreschen“ als Vorwurf gegen ein anderes Volk erhoben wird, trifft dies dann nicht auch Israel selbst (vgl. (Jes 41,15; Mi 4,13)? Dasselbe gilt auch für den Vorwurf, Schwangeren den Bauch aufzuschlitzen. Wenn der israelitische König Menahem nach einer Notiz in 2 Kön 15,16 im Kampf um den Thron die Frauen der eroberten Stadt Tifsach aufschlitzen ließ, handelt er genauso verwerflich wie eines der Nachbarvölker.
1,14Ziel der Strafhandlung ist die ammonitische Hauptstadt Rabba, das heutige Amman. Was die vorangehenden Strophen mit dem wiederkehrenden Motiv des Feuers gegen Stadtmauer und Paläste und den jeweiligen Erweiterungen schon deutlich machten, wird hier ausgesprochen: Es geht um angekündigte kriegerische Handlungen gegen die bedrohte Größe. Wie durchgängig wird auch hier nicht gesagt, wer den zerstörenden Krieg führen wird. Eigentliches Subjekt ist natürlich Jhwh, der das Feuer an die Mauer legt. Aber wer in seinem Auftrag Krieg führt, bleibt offen. Rhetorisch aktiviert eine solche Leerstelle die Phantasie derer, die einen solchen Text hören oder lesen. Sind Werkzeug Jhwhs die Israeliten, die Rache nehmen an ihren Nachbarn? Oder ist es eine der Großmächte der Zeit, die Assyrer oder Babylonier, die Israels Nachbarvölker auf ihren Eroberungszügen heimsuchen werden? Der Text lässt die Antwort offen.
1,15Noch eindeutiger als in den vorangehenden Strophen wird gesagt, dass die Katastrophe für die Ammoniter primär deren herrschende Schicht trifft. V. 15 nennt „ihren König“ und „seine שׂרים ( śārîm )“, was Luther mit „Fürsten“ wiedergab, was aber eher „Beamte“ 47oder „Würdenträger“ meint. Der König als Spitze und seine Beamten als engstes Machtgremium bilden die Führungselite damaliger westasiatischer Staaten. So erscheint es bei Salomo, wo „der König“ und „die Beamten, die er hatte“, aufgezählt werden (1 Kön 4,1–2), so verhält es sich in den Jeremiaerzählungen (vgl. etwa die Konstellation in Jer 36,21, wo Jeremias Schriftrolle „dem König und allen Beamten, die beim König standen“, vorgelesen wird), so wird es aber auch bei Israels Nachbarvölkern vorausgesetzt (vgl. im Blick auf Elam die Zusammenstellung „König und Beamte“, Jer 49,38).
Natürlich besagt die Ankündigung, dass „ihr König zusammen mit seinen Würdenträgern in die Verbannung geht“ nicht, dass das Volk der Ammoniter vom „Lärm am Tag des Krieges“, vom „Brausen am Tag des Sturms“ nicht betroffen wäre. Die Aussagen vom „Dreschen mit eisernen Dreschschlitten“ und vom Aufschlitzen der Schwangeren zeigen zur Genüge, dass damalige Kriege so wenig wie heutige ernsthaft zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheiden. Die Völker, ob als Soldaten oder Zivilisten, müssen immer unter den Folgen der Kriege leiden, die die Herrschenden zu verantworten haben. Dennoch ist es für die Völkersprüche und das gesamte folgende Amosbuch wesentlich, dass die Verantwortlichen klar benannt und auch als Erste zur Verantwortung gezogen werden.
2,1Als sechstes und letztes Nachbarvolk von Juda und Israel wird Moab genannt. Das Siedlungsgebiet Moabs liegt östlich des Toten Meeres, mit den Ammonitern im Norden und Edom im Süden als Nachbarn.
Mit der Moab-Strophe tritt ein markanter Wechsel in den Völkersprüchen ein. Alle fünf bisherigen Strophen behandelten Verbrechen, deren Opfer in Israel oder Juda zu suchen waren. So konnte man die ersten fünf Strophen so lesen, dass sie Verbrechen gegen Juda und Israel anklagen und den schuldigen Nachbarn das Strafhandeln des Gottes Israels ankündigen.
Diese Lesart wird nun durch die Moabstrophe irritiert. Denn Moab werden keine Verbrechen gegen Israel oder Juda, sondern gegen Edom vorgeworfen. Moab habe „die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt“, also den Leichnam des edomitischen Herrschers geschändet. Die ordentliche Bestattung und die Unverletzlichkeit des Grabes sind in der Antike ein hohes Gut. 48Gräber versucht man auf Inschriften dadurch zu schützen, dass Räuber und Grabschänder mit Flüchen abgeschreckt werden, so in Jerusalem (HAE Jer[7]:1–2), im phönizischen Sidon (KAI 13 und 14) und in den umliegenden Kulturen. Dass die Gräber geöffnet und die Gebeine unter freiem Himmel ausgestreut werden, gilt als schwere Drohung wegen schlimmster Vergehen (Jer 8,1–2). Wenn es hier heißt, man habe die Gebeine „zu Kalk verbrannt“, soll wohl damit „die Wirkung des Feuers als vollständig … charakterisiert“ werden, wie aus der Parallele in Jes 33,12 hervorgeht, wo es heißt, dass „Völker zu Kalk verbrannt werden“. 49
Brutalitäten wurden auch in den vorangehenden Strophen beklagt. Aber in der Moabstrophe ist ein fremder König das Opfer, gar der König eines Landes, das selbst im Völkergedicht beschuldigt und bedroht wird. Damit beginnt das, was in den ersten fünf Strophen offenblieb, sich zu schließen. Man konnte sie so lesen, dass es um die Rachewünsche gegen die ging, die Juda und Israel bedrängten. Schon da lag gelegentlich die Frage nahe, ob sich das dann nicht auch gegen eigenes Verhalten richten müsse. Nach der Moabstrophe wird eine triumphalistische Lesart fast schon unmöglich. Die Brutalität der Anderen wird nicht verurteilt, weil sie gegen Israel gerichtet ist. Sie wird vielmehr verurteilt, weil sie, modern gesprochen, den Charakter eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit hat.
Читать дальше