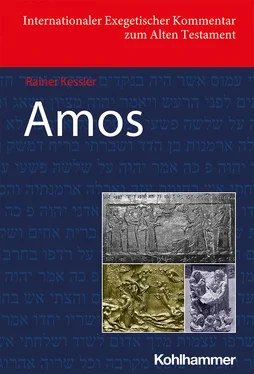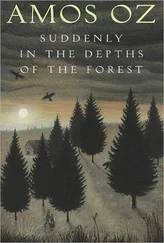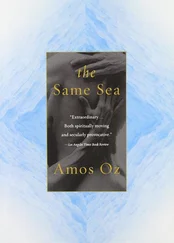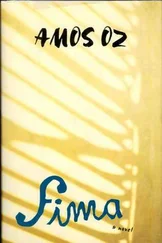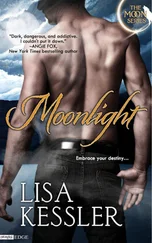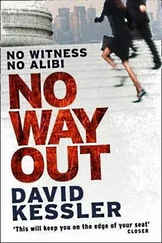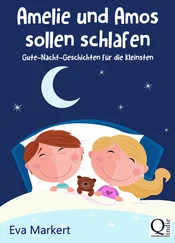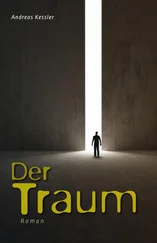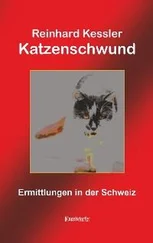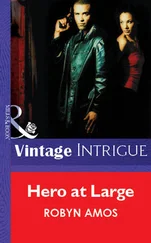Und ein Weiteres ist zu beachten. Zwar wird hier wie an anderer Stelle (2 Kön 13,7) eine fremde Macht des „Dreschens“ bezichtigt. Aber es finden sich auch prophetische Ansagen, in denen die Fähigkeit, mit scharfen Klingen am Dreschschlitten zu dreschen, durchaus positiv als Verheißung für Israel erscheint (Jes 41,15; vgl. Mi 4,13). Auch auf die Möglichkeit, dass der Vorwurf der Gewalttätigkeit, wenn er gegen die Feinde Israels erhoben wird, auf Israel selbst zurückfallen könnte, werden wir noch zurückkommen müssen.
1,4Das 4. Formelement, das in allen Strophen bis auf die Israelstrophe vorkommt und hier in V. 4 vorliegt, kündigt nun Jhwhs strafendes Eingreifen an: „So schicke ich Feuer gegen das Haus Hasaels, damit es die Paläste Ben-Hadads frisst.“ Durchgängig ist Feuer das Strafwerkzeug. Dahinter steht der Gedanke, dass Jhwh eine besondere Affinität zum Feuer hat. Er erscheint im Feuer (Ex 19,18). Er verfügt über das Feuer, um strafend einzugreifen (Gen 19,24), was dann auch der Gottesmann in seinem Namen vermag (2 Kön 1,9–16). Feuer frisst aus Gottes Mund (Ps 18,9), seine Stimme sprüht Feuerflammen (Ps 29,7). Wer solche Macht über das Feuer hat, kann es auch zum Strafen einsetzen, auch wenn nicht näher ausgeführt wird, wie man sich das Auftreten des Feuers vorstellen soll: als Feuerregen vom Himmel oder eher als Feuer, das feindliche Soldaten legen und dessen Herkunft auf Jhwh zurückgeführt wird.
Wichtiger als die Frage nach seiner Herkunft ist die, worauf das Feuer zielt: Es sind die Symbole der Herrschaft, das „Haus Hasaels“ und die „Paläste Ben-Hadads“. Mit Hasael muss der wohl 842/841 v. Chr. wahrscheinlich als Usurpator an die Macht gekommene aramäische König gemeint sein (vgl. 2 Kön 8,7–15), der wie erwähnt Gilead und das Ostjordanland erobert hat (2 Kön 10,32f.). Der an zweiter Stelle genannte Ben-Hadad, in der Bibel ein häufiger Name für Aramäerkönige (vgl. 1 Kön 15,18 mit 2 Chr 16,2.4; 1 Kön 20; 2 Kön 6,24), ist dann wohl Hasaels Sohn und Nachfolger (2 Kön 13,24f.). 28Der Parallelismus bei den Namen legt nahe, dass beim „Haus“ wie bei den „Palästen“ an die jeweiligen Gebäude gedacht ist (und nicht etwa übertragen an die „Dynastie“, was beim Haus gut möglich wäre). Sie als die Symbole der Macht der Aramäerkönige sollen von dem Feuer, das Jhwh schickt, verzehrt werden.
1,5Mit V. 5 kommen wir zum 5. Formelement, bestehend aus vier Halbzeilen weiterer Drohungen gegen Damaskus. Die erste heißt: „Ich zerbreche den Torriegel von Damaskus.“ Die Trias von Mauer, Toren und Riegeln steht für den Schutz einer befestigten Stadt (Dtn 3,5; Ez 38,11; 2 Chr 8,5; in 2 Chr 14,6 noch um die Türme ergänzt). Auch nur zwei dieser Abwehrmittel, Tore und Riegel (1 Sam 23,7) oder Mauern und Riegel (1 Kön 4,13), können genannt sein. Und wenn wie in Am 1,5 nur der Riegel erwähnt wird, steht er pars pro toto für die Befestigung der Stadt. Wird der Riegel zerbrochen (so mit derselben Wurzel wie hier in Jer 51,30) oder auf andere Weise zerstört (Jes 45,2; Nah 3,13; Ps 107,16), dann ist die Stadt den Eroberern schutzlos ausgeliefert.
V. 5aβ und γ nennen als nächstes in chiastischer Stellung zwei Herrschergestalten. In V. 5aβ ist der Bezug auf einen Herrscher allerdings noch nicht eindeutig, wie in den Bemerkungen zum Text schon erläutert wurde. Denn der genannte יושׁב ( jôšēb ) könnte auch generell der „Bewohner“ sein. Doch legt es der Parallelismus mit dem in V. 5aγ genannten „Zepterträger“ nahe, im יושׁב ( jôšēb ) den „Thronenden“ zu sehen. 29Beide Herrscher werden mit Ortsnamen verbunden. Biqat-Awen bezieht sich wohl auf das Gebiet der Biqaʿ-Ebene zwischen Libanon und Antilibanon. Allerdings stellt die Bezeichnung mit dem Element Awen einen „Kakophemismus“ dar, 30denn wörtlich heißt dies „Tal des Unrechts“. Der zweite Ortsname Bet-Eden meint dagegen das aus assyrischen Quellen bekannte Bît Adini, einen aramäischen Staat beiderseits des oberen Euphrat. Die Vorstellung des Verses ist wohl die, dass hier „zwei Teilstaaten“ genannt werden sollen, „die Damaskus bei- oder aber untergeordnet waren und repräsentativ für andere stehen“. 31
Mit dem vierten Element der Aufzählung ist die Klimax in V. 5 erreicht. Nach einer Sache, dem Riegel, und zwei Einzelpersonen, dem Herrscher und dem Zepterträger, ist nun „das Volk“ betroffen, das als Folge des strafenden Eingreifens „in die Verbannung von Aram nach Kir“ zieht. Kir, das in Jes 22,6 in Parallele zu Elam steht, ist wohl nördlich des späteren Siedlungsgebiets der Aramäer zu suchen. 32Nach Am 9,7 habe Jhwh „Aram aus Kir“ heraufgeführt, wie Israel aus dem Land Ägypten und die Philister aus Kaftor. Im Spannungsbogen von Am 1–9 besagt unser Vers 1,5 also: „Die Deportation soll die Aramäer dahin zurückbringen, woher sie gekommen sind.“ 33Wenn nach 2 Kön 16,9 behauptet wird, Tiglatpileser von Assur habe im Jahr 732 tatsächlich Damaskus nach Kir deportiert, dann ist das allerdings „keine historische Angabe, sondern eine späte, der LXX noch unbekannte Folgerung der Schriftgelehrsamkeit aus unserer Stelle“. 34
Die Ausdrucksweise von Am 1,5b ist insofern unscharf, als der Ausdruck „das Volk von Aram“ vieldeutig ist. Vor dem Hintergrund von Am 9,7, wo nur „Aram“ steht und dieses sich in Parallele zu „Israel“ und „den Philistern“ findet, ist das Volk als Kollektiv gemeint: Ganz Aram soll in die Verbannung. Bleiben wir innerhalb der Völkersprüche, liegt eine solche kollektive Auffassung aber nicht unbedingt auf der Hand. Denn hier ist nicht von „Aram“, sondern vom „Volk von Aram“ die Rede. Und עם ( ʿām ) kann nicht nur das Volk als Kollektiv, sondern auch das Kriegsvolk im engeren Sinn bezeichnen. Es ist durchaus „eine mögliche“, vielleicht „sogar wahrscheinliche Deutungsmöglichkeit“, dass hier primär an das Kriegsvolk von Damaskus gedacht ist, das infolge der militärischen Niederlage verbannt wird. 35Allerdings sollte man daraus keinen Widerspruch konstruieren. Von Verbannungen waren immer primär die militärischen, politischen und geistigen Eliten betroffen. Aber das Volk als ganzes wurde bei einer militärischen Katastrophe keineswegs verschont.
Das kurze 6. Element schließt die I. Strophe ab: „spricht Jhwh“.
1,6Die II. Strophe des Völkergedichts wendet sich gegen die Philister. Dieses Volk, das am Ende des 2. Jahrtausends in die südliche Levante eingewandert ist, war politisch nie in einem Flächenstaat, sondern immer in Stadtstaaten organisiert. Dies schlägt sich in unserem Text darin nieder, dass er zunächst in Vv. 6–7 nur von Gaza spricht. Diese südlichste der Philisterstädte wurde 734 von Tiglatpileser III. erobert und zu einem assyrischen Außenhandelsplatz gemacht, blieb aber als selbstständiger Vasallenstaat bestehen. 36In V. 8 kommen dann mit Aschdod, Aschkelon und Ekron weitere Philisterstaaten hinzu. Aschdod wurde im Jahr 711 von den Truppen Sargons II. erobert und in eine assyrische Provinz verwandelt. 37Auffällig ist, dass der fünfte Stadtstaat, der von Gat, hier nicht erwähnt wird. Das mag daran liegen, dass Gat schon im 9. Jh. von den Aramäern zerstört wurde und danach nur zusammen mit Aschdod politisch aktionsfähig war. 38Im weiteren Amostext können dann allerdings auch allein Aschdod (3,9) oder Gat (6,2) für die philistäischen Nachbarn von Israel und Juda stehen. Im Völkergedicht benennt erst der letzte Halbvers die Philister als Volk.
Nach V. 6 besteht das Verbrechen Gazas darin, „dass sie Bevölkerungen geschlossen verschleppt haben, um sie an Edom auszuliefern“. Der Hintergrund der Vorwürfe bleibt weitgehend unklar. Sind Auslöser Grenz- und Gebietsstreitigkeiten? Kam es im Zusammenhang mit der Aktion Tiglatpilesers III. gegen Gaza zu lokalen Konflikten zwischen Philisterstädten und Israeliten (oder Judäern)? Belegt ist diesbezüglich nichts. In Ez 16,57 und Ez 25,15–17 ist von philistäischen Feindseligkeiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch Judas nach der Eroberung Jerusalems 586 die Rede. Aber Verschleppungen werden da nicht genannt.
Читать дальше