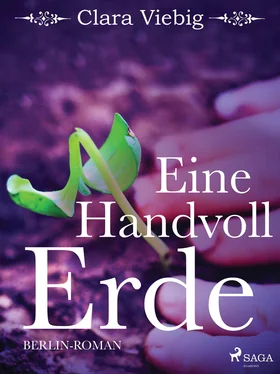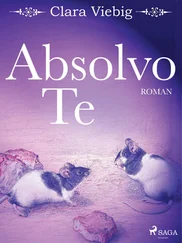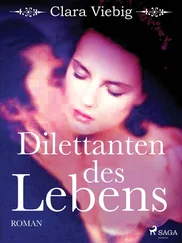Heute hatte Frida einen weiten Weg gehabt. Ganz oben in der Wilhelmstraße, dicht am Belleallianceplatz, schneiderte sie für die Hausdame von Doktor Hirsekorn einen Morgenrock. Früh langte die Zeit manchmal nicht, aber abends ging sie immer zu Fuß, auch diesen weiten Weg. Es tat ihr gut, daß sie sich Bewegung machte, sie hatte eine üppige Figur, eine volle Brust, und doch zeigte ihr rundes Gesicht das weiche Wachsblaß der Bleichsüchtigen.
Jetzt stand sie in der Küche und rang nach Luft.
»Na, was denne?« Mine war ein bißchen ängstlich, nicht weil es so spät war – es wurde schon ab und zu einmal halb elf – aber weil Frida so nach Luft schnappte. Sie sollte sich doch nicht so abjagen. »Warum biste denne so gerannt? Hast du unten so ufgequiekt?«
Unter des Mädchens blasse Haut schoß eine Blutwelle, sie schüttelte stumm den Kopf.
»Is dir niemand begegnet?«
»Nein«, sagte Frida, aber ihr Gesicht wurde noch röter. Mit einem gewissen Mißmut zog sie die Jacke aus und nahm den Hut ab. Hübsch war sie eigentlich nicht, aber im Dunkeln konnte sie wohl locken mit der üppigen Brust und dem mächtigen Knoten der starkblonden Haare.
»Ist das heut abend noch warm, schrecklich warm! Machs Fenster weit auf, Mutter! Zum Ersticken!«
Was war denn die Frida heut so aufgeregt? Mine sah stillschweigend zu, wie die Tochter die Taille, die sie einzwängte, auszog, hinter die Gardine an der Wand hing und in ihre Nachtjacke schlüpfte. Sie saß dann auf dem Küchenschemel, schlang die Hände um die Knie, beugte den Oberkörper vor und blieb so wie in Gedanken.
»Haste Verdruß gehabt?« fragte die Mutter. Sie sah es der Tochter doch an.
Frida nickte. Und dann lösten sich plötzlich zwei Tränen aus ihren starrenden Augen und fielen ihr in den Schoß.
»Haste was verschnitten?« Nun war Mine ernstlich beunruhigt. »Sag doch, Fridchen, was haste denne?«
»Meine beste Kundschaft, meine allerbeste Kundschaft – ach Mutter, der Doktor zieht von Berlin weg!«
»Na, für den machste doch nich de Kleider!« Mine war etwas verdutzt; dann tröstete sie: »Du wirst wieder ’ne andere gute Stelle kriegen. Zieht denn seine Mamsell, das Fräulein Zimmer, auch mit weg von Berlin?«
»Sie sagt: ›Nein, auf keinen Fall‹. Aber –« das Mädchen konnte sich gar nicht beruhigen – »ich bin doch so traurig, so traurig!«
Das war doch kein Grund gewesen, um zu weinen! Die Mutter hatte die Tür der Stube nach der Küche zu aufgelassen. Sie hörte, wie die Tochter sich dort im Bette warf. Arthur war noch nicht da, sie waren beide ganz allein. »Fridchen«, rief die Mutter, »schläfste noch nich?« Aber die Tochter antwortete nicht.
Frida Reschke schlief nicht. Sie lag ganz still auf dem Rücken und sah nach dem Fenster, dessen unverhängte Scheiben ein mattes, trübes Gelbgrau durchließen. Kein Mond, kein Stern warf Silberlicht herein. Das war alles so traurig, wie der ganze Tag heute gewesen war. Fröhlich war sie heut morgen zur Arbeit gegangen, das heißt, so fröhlich wie man sein kann, wenn man Tag für Tag immer dasselbe tun muß: nähen, immer nähen und flicken und stopfen. Jede Stunde am Tag gehört der Kundschaft, jede Minute; gerade daß man aussetzt, wenn einem das Essen gebracht wird. Wer doch einmal aufhören könnte zu nähen, immer zu nähen! Aber das würde nie aufhören, man nähte sein ganzes Leben lang. Man blieb sitzen in dieser Nähstube, hinten am langen Gang, durch den die Mägde trappeln, wenn es vorne schellt, in dieser Nähstube, die so voll ist von Schränken, daß gerade die Maschine noch Platz hat und ein Tisch. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, rufen sie herein: »Frida, machen Sie doch meiner Puppe ein neues Kleid, ja?!« Und der Kleinste tippt auf die Maschine: »Laß mich auch mal drehen –rrrrrr!« Das war die einzige Abwechslung – und ein ganzes Leben so?!
Frida stieß mit einem heftigen Ruck die Füße unten gegen die Eisenbettstatt. Da hatten es die Mädchen bei Wertheim doch besser, oder in irgend einem anderen großen Geschäft, wo die Käufer ein und aus fluten und man etwas sieht von der Welt. Nein, die hatten es auch nicht besser! Nein, alle Mädchen, die im Trott gehen müssen einen Tag wie den anderen, haben’s nicht besser!
Frida schloß die Augen, sie schämte sich vor sich selber: was war ihr doch nur angeflogen, daß sie heute solche Gedanken hatte?
Das kam von dem lauen Abend, an dem es einen förmlich heraus aus den Straßen trieb. Wer doch Zeit genug hätte, spazieren zu gehen! Denn das war kein Spazierengehen, dieses Laufen durch die Straßen. Ja, die Mutter, die hatte es gut gehabt, die war aufgewachsen auf dem Lande, darum war sie auch jetzt noch stark und fast jugendlich, trotzdem sie ein so schweres Leben gehabt hatte. Sie, die Näherin, würde nicht so lange jung bleiben. Bleichsüchtig – bleichsüchtig. Der Herr Doktor war heut einmal in die Nähstube gekommen – der gestreifte Morgenrock lag auf der Maschine, dieses ewige Gestreift-Sehen machte ganz schwindelig – er sagte: »Sie sehen blaß aus, mein Kind, Sie müssen diesen Sommer mal ein bißchen heraus!«
Ja wohl, heraus! Wovon denn? Wohin denn?! Sie mußte doch sparen. Die Mutter sparte, die Tochter sparte – die Mutter wusch und wusch, sie nähte und nähte – die Mutter sparte für das kommende Alter, die Tochter sparte für den künftigen Hausstand. O Gott nein, nur nicht! Nur nicht so heiraten, wie die Mutter geheiratet hatte!
Frida schauderte. Sie konnte sich gut erinnern an ihre Kinderzeit. Da war es ihnen sehr schlecht gegangen. Sie war oftmals hungrig ins Bett gekrochen, sie hatte oftmals gefroren. Nur die Liebe der Mutter hatte ihr weggeholfen über Hunger und Frost.
Wie war es heiß und beklemmend hier! Frida warf die Decke ab. Wäre sie doch heut abend nur nicht zu Fuß nach Hause gegangen! Sie war schon verstimmt gewesen, es konnte ihr doch nicht einerlei sein, daß der Doktor, der immer so freundlich zu ihr war, in dessen Haus ihre beste Stelle war, daß der nun ganz fortzog von Berlin.
Er könnte es nicht mehr aushalten hier, sagte Fräulein Zimmer. Die begriff das nicht. Gerade in der Wohnung, in der er mit seiner Frau so glücklich gelebt hatte und in der sie ihm gestorben war, müßte er doch wohnen bleiben. Nicht, daß er immer zu ihr nach dem Kirchhof zu laufen brauchte, wie das übrigens eigentlich zu begreifen wäre, wie sie es wenigstens tun würde, sagte Fräulein Zimmer, wenn sie einen Mann da begraben hätte – aber es wäre eine fixe Idee von ihm, daß er sich draußen besser fühlen würde, daß er da auch leichter wegkäme über den Verlust.
Frida richtete sich halb auf, ihre Augen wurden groß. Wenn sie nun heute mit dem Herrn gegangen wäre, der sie verfolgt hatte von der Friedrichstraße an – ?! Wie sie nur plötzlich darauf kam, sie war doch bei ganz anderen Gedanken gewesen?! Jetzt fühlte sie es: dieser Gedanke hatte auf sie gelauert die ganze Zeit.
In der Friedrichstraße hatte er sich ihr angeschlossen; er war wohl schon eine Weile hinter ihr her gewesen, sie hatte es nur nicht bemerkt, nun aber, da sie an einem Schaufenster stand, sprach er sie an. Sie wurde öfters abends angeredet; das passiert allen Mädchen, aber dieser Mann zog den Hut dabei. Und wenn sie ihm auch gar nicht antwortete, ihn nicht einmal ansah, er blieb immer hinter ihr. Die ganze Friedrichstraße hinunter, über die Weidendammer Brücke, die Chausseestraße entlang. Sie wurde ganz verwirrt: hatte der eine Ausdauer!
Es gingen viele Füße hinter ihr. Aber diesen Tritt hörte sie ganz genau heraus. Sie ging rascher, da wurde der auch rascher – sie ging langsamer, da verlangsamte sich der auch. Und je weiter sie in die Chausseestraße hineinging, desto näher kam er ihr; er war ihr dicht auf den Fersen. Als sie in die Tieckstraße einbog, wo es schon anfängt mit den Hotels, mit den Türen, darüber auf den matterleuchteten Milchglasscheiben zu lesen steht: »Zimmer zu 1 M. 50’ sprach er sie wieder an. Es war, als ob er hier doppelt dreist wäre. Und er drückte sich an ihren Arm und drängte sie dicht an so ein Haus heran.
Читать дальше