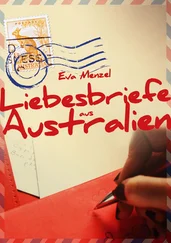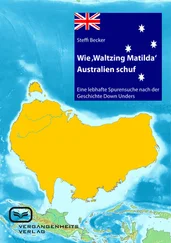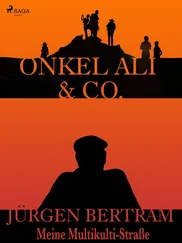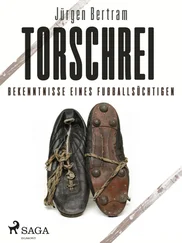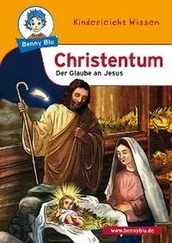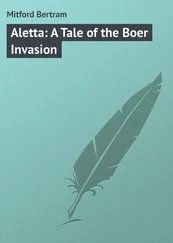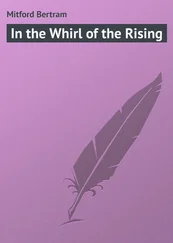Ein Leben im Takt der Achterbahn: Regina und Udo Wiebelskircher
»Ist es ein gefährlicher Job?«
»Nur in krokodilreichen Gegenden. Aber wenn ich an den Flussmündungen im Norden tätig bin, steht immer jemand mit dem Gewehr neben mir. Der würde sofort schießen, wenn mir ein Krokodil zu nahe käme.«
Auch für Regina Wiebelskircher hat sich die Geduld, die sie im Existenzkampf bewiesen hat, am Ende gelohnt. Sie arbeitet jetzt selbstständig für einen Grundstücksmakler, vermietet Immobilien für ihn. In einer Gesellschaft, zu deren Merkmalen seit jeher Mobilität und Fluktuation gehören, ist das ein blühender und auch angesehener Geschäftszweig.
»War es schwer, in diesen Beruf einzusteigen?«
»Überhaupt nicht. Man absolviert einen vierwöchigen Kurs, bezahlt dafür 1200 Dollar – und dann heißt es nur noch: ›Off you go!‹ In Deutschland könnte ich einen solchen Job nicht ohne Lehre ausüben. Da musst du doch schon eine Prüfung ablegen, wenn du den Rasen betreten willst.«
»Wie oft reisen Sie nach Deutschland?«
»Alle zwei Jahre.«
»Welchen Eindruck haben Sie, nachdem Sie dort gelandet sind?«
»Es ist furchtbar. Du bist kaum aus dem Flugzeug raus, da wirst du schon von irgendwelchen Beamten belehrt. Dann willst du morgens um fünf auf dem Bahnhof ein Ticket kaufen und hast nur einen großen Schein dabei, weil du ja gerade aus Australien kommst. Aber da heißt es gleich: ›Also, Kleingeld muss man immer bei sich haben!‹ Wenn man etwas falsch macht, dann ist gleich immer großes Theater, dann wird man von oben bis unten angeguckt.«
»Und wie ist das in Australien?«
»Da will man dir immer helfen. Ich bin mal in Melbourne direkt unter einer Autobahnbrücke mit einem Achsbruch liegen geblieben und habe Udo angerufen. Es ist unglaublich, wie viele Autofahrer in der Stunde, die ich auf ihn gewartet habe, anhielten und mir ihre Hilfe anboten. In Deutschland hätte man mich nur angeglotzt.«
Die Variationen des Lächelns, mit denen Udo Wiebelskircher die Suada seiner Frau begleitet, verraten Einverständnis mit dem Trend, aber Abweichung im Detail. »Ja, es stimmt, der Service ist miserabel in Deutschland. Aber wenn ich an die Kneipen denke, die alten Städtchen, die Kultur – das gefällt mir bei unseren Besuchen immer wieder. Und das vermisse ich in Australien.«
»Gibt es etwas, was Ihnen in Australien besonders missfällt?«
»Die Verherrlichung der Gewalt im Sport. Rugby, Football – da geht es wirklich brutal zu. Und irgendwie durchzieht das die gesamte Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, dass jemand, der in eine Schlägerei verwickelt ist, besser wegkommt, als einer, der bei Rot über die Kreuzung fährt.«
Darwin, am nächsten Abend. Wir sind zu Gast im »Night Cliffs Sports Club«. Das Ehepaar Wiebelskircher hat uns eingeladen. »Ordentliche Kleidung« verlangt die Vereinsordnung. Das bedeutet: »Nach 19 Uhr keine Schlappen, zu keiner Zeit schmutzige Arbeitskleidung.« Das ist kein antiquierter Dresscode, sondern die Festlegung auf ein Minimum.
An einem Ecktisch des mit geldfressenden Spielautomaten ausgestatteten Saales tagt der harte Kern des »Deutschen Clubs«. Udo Wiebelskircher steht ihm vor. Harry Maschke, der Unternehmer und Konsul, hatte das Amt auch schon mal inne. Die Herren spielen Skat, die Damen Canasta. In den Kommentaren, ohne die keine solche Runde auskommt, vermischen sich Deutsch und Englisch. »Ick hab’ nur rubbish «, schimpft Vera aus Berlin. Sie ist mit Jürgen verheiratet, einem Maschinenschlosser aus Harry Maschkes Betrieb. Eine Partie später klagt Vera: »Ick hab’ noch immer keenen jolly jezogen!«
Der »Deutsche Club« war mal eines der gesellschaftlichen Zentren Darwins. Heute ist er auf sechzig Mitglieder geschrumpft – obwohl die Zahl der Deutschen zugenommen hat. »Darwin«, erläutert Udo Wiebelskircher, »hat sich zu einer multikulturellen Stadt entwickelt. Menschen aus sechzig Nationen leben hier mittlerweile zusammen. Die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie auf die anderen zugehen. Ich glaube, keine Nation integriert sich schneller in die Gesellschaft. Auch wir im Club sind keine Vereinsmeier, sondern offen für alle.«
»Demnächst«, ergänzt Regina Wiebelskircher, »gründen wir in Darwin einen europäischen Club. Das ist zeitgemäßer. Aber unsere Tochter wird auch daran kaum Interesse haben. Sie ist jetzt 32 und arbeitet als Laborantin in einem Krankenhaus. Die versteht sich als waschechte Aussie.«
Es ist unser letzter Tag in Darwin. Die Chance, diesen Kreis nach deutschen Auswanderern zu fragen, die an unserer Reiseroute residieren, lassen wir uns nicht entgehen. So viele Namen werden uns wie auf Startschuss serviert, dass wir Mühe haben, sie zu sortieren.
»Also die Frauke, die hat ’nen Schmuckladen in Kununurra, gleich gegenüber von Woolworth.«
»Der Bernie Ostermeier ist ein interessanter Typ. Der hat einen Lastwagen konstruiert, dessen Ladefläche sich beim Kippen zur Seite dreht. Millionär ist der mit dem Patent geworden.«
»In Bathurst, da gibt’s eine Tankstelle, die einem Deutschen gehört. Kein Wort Englisch konnte der, als er nach Australien kam. Läuft prima, der Laden.«
»Den Werner in Katharine, den müsst ihr auch unbedingt besuchen. Der betreibt dort ein Reisebüro. ›The king of Katherine‹, nennen sie den.«
Katherine? In diese Richtung fahren wir morgen.
4 »Und plötzlich war ich Metzger«
Der König von Katherine
Ameisen kennen keine Mittagspause. Auch wenn es »High Noon« ist in Katharine, herrscht Hochbetrieb auf ihren Straßen. Als seien sie zu ewigem Gerenne verdammt, streben sie, im Zickzack zumeist, irgendwelchen Zielen zu. Manche transportieren Material für den Ausbau ihrer Nester. Andere wieseln um ihre Königin, ein Prachtexemplar mit silbernen Flügeln. Ein kurzes Stampfen mit dem Fuß genügt, und schon sprudeln Hunderte neuer Leiber aus den Löchern der rostroten Erde. Keine Minute dauert es, bis sich alles wieder in 40 die hergebrachte Ordnung fügt.
Wendet man seinen an mitteleuropäische Hektik gewohnten und auf ständige Abwechslung gepolten Blick zurück auf die Nationalstraße Nummer eins, die das 315 Kilometer südlich von Darwin gelegene Städtchen durchschneidet, glaubt man für einen Moment, die Hitze habe das Leben erstarren lassen. Ein Zischen beim Öffnen einer Bierdose, ein Gurren aus dem Grün hinter dem Fluss, der auch Katherine heißt, sind zu dieser Stunde seine einzigen Signale.
Am Nachmittag haben wir einen Termin mit dem Reiseunternehmer, den uns die Skatspieler in Darwin als den »König von Katharine« avisierten. Bei unserem ersten Rundgang durch sein Reich, mit dem wir, keinerlei Systematik folgend, die Zeit überbrücken, bleibt uns auch das Elend der Aborigines, der Nachfahren der australischen Ureinwohner, nicht verborgen. Eine Großfamilie döst, von Schnapsflaschen eingekreist, im Schatten eines riesigen Eukalyptusbaumes. Eine Gruppe von Frauen, in deren Gesichtern sich die Härte des Alltags abbildet, wartet vor einer Sozialstation ungeduldig auf Einlass. Das therapeutische Angebot, das man in fetten Buchstaben auf deren Frontscheibe gepinselt hat, beschreibt zugleich einen gesellschaftlichen Teufelskreis: »Arbeitslosigkeit«, »Häusliche Gewalt«, »Kindesmissbrauch«.
Neben dem Eingang zum Freizeitzentrum für Jugendliche hängt ein Hinweis, der mit dem Begriff »Regeln« überschrieben ist und den Duktus der desperaten Klientel zu treffen versucht: »Hey, ihr Typen! Seid ihr wieder besoffen? Wenn ihr hierherkommt, habt ihr euch dem Boss unterzuordnen. Wenn ihr euch prügelt und dabei Sachen zu Bruch gehen, dann ruft der Boss die Polizei, und ihr landet im Knast. Für alles, was ihr demoliert, müsst ihr selbst blechen. Ist das klar?«
Die hautnahe Konfrontation mit der Realität ruft jene beklemmenden Fakten ins Bewusstsein, die man aus den Medien kennt: Die Lebenserwartung ist bei den Aborigines um zwanzig Jahre niedriger als bei der übrigen Bevölkerung, das Risiko, ermordet zu werden, achtmal höher. In vielen ihrer Siedlungen gelten Mädchen, die mit zehn Jahren noch Jungfrau sind, als die absolute Ausnahme.
Читать дальше