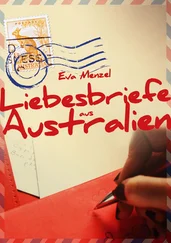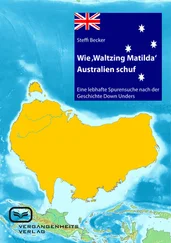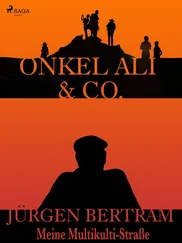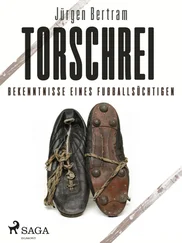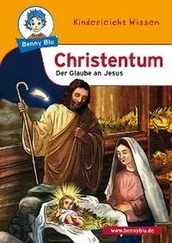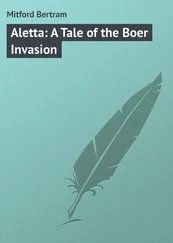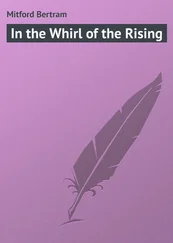Der Fluss, der sich so lange als Segen erwies, wird für den Ort und seinen Ehrenbürger Werner Sarny 1998 zum Fluch. Zwei Meter tritt er in der Regenzeit über die Ufer und setzt die 7000-Einwohner-Gemeinde komplett unter Wasser. Zwei Menschen kommen ums Leben, Dutzende werden verletzt. Bilder von der Flut gehen um die ganze Welt. Der materielle Schaden treibt viele Familien in den Ruin.
Auch Werner Sarny erleidet durch das Hochwasser einen Verlust in Millionenhöhe. In einer Gegend, in der man Geschäfte noch per Handschlag besiegelt, vergisst man schnell, so der Unternehmer, »in Versicherungsverträgen das Kleingedruckte zu lesen«. Dass seine Firma dieses Desaster verkraftet, lässt ahnen, welch ein Vermögen sie in drei Jahrzehnten erwirtschaftet hat und warum man ihren Eigentümer den »König von Katherine« nennt.
Ein Taifun, der, wie in Darwin, eine Stadt in eine einzige Ruine verwandelt, eine Flut, die, siehe Katherine, ein Gebiet von der Größe der Bundesrepublik von der Außenwelt abschneidet – überall im tropischen Norden ist die Konfrontation mit den Urgewalten der Natur ein Bestandteil der Existenz. Fotos von Bürgern, die sich in Schlauchbooten durch die Landschaft bewegen, oder von Viehherden, von denen nur noch die Köpfe aus dem Wasser ragen, gehören in den Kneipen, Krämerläden oder Tankstellen zum Standarddekor. Im Zentrum von Katharine informiert seit 1998 ein Schaukasten darüber, wie man sich bei einer Flut angemessen verhält: »Halten Sie jederzeit Schlafsäcke, Zelte, warme Kleidung und batteriebetriebene Taschenlampen bereit. Überlegen Sie als Erstes, ob Sie jemanden in höher gelegenen Gegenden kennen. Und denken Sie daran, dass auch Ihr Haustier nach einer solchen Katastrophe unter Verwirrung und Angstzuständen leidet.«
Trotz allem: Werner Sarny zieht die gefährdete Weite Australiens der sicheren Enge Europas vor. Auch für diesen Auswanderer hat sich der Traum erfüllt, selbstständig zu werden, statt abhängig zu bleiben. Und so fürchtet er den Stillstand mehr als die nächste Flut. Mit 54 Jahren in Frührente zu gehen, wie seine in Österreich lebende Schwester, das wäre für ihn, wie er sagt, »der reinste Horror« gewesen. »In diesem Alter habe ich noch neunzig Stunden in der Woche für mein Unternehmen gearbeitet.«
Seine markantesten Erinnerungen an einen Besuch in Wien kreisen um ein sehr alltägliches Problem: die ewige Suche nach einem Parkplatz. »In der Innenstadt hieß es dauernd: ›Hier können Sie nicht stehenbleiben!‹. Als ich mein Auto mal am Flughafen abstellen wollte, bin ich mehr als zwei Stunden vor meinem Flug losgefahren. Aber das Parkhaus, für das man fünfzig Euro pro Tag bezahlen musste, lag zwei Kilometer von der Abflughalle entfernt. Meinen Flug habe ich verpasst.«
Werner Sarnys neueste Errungenschaft sind zehn Schulbusse, die jeden Tag Kinder in einem Umkreis von hundert Kilometern transportieren. Als er sie uns mit dem Stolz des Patriarchen präsentiert, verlieren sich die Fahrzeuge auf einem mehrere Fußballfelder großen Areal in der Nähe seines Bungalows. Probleme mit Parkplätzen gibt es nicht in Katharine – es sei denn, das Städtchen steht mal wieder unter Wasser.
5 »Hier ist einfach gar nichts«
Als Köchin in den Kimberleys
Warum, so fragt man sich auf der Fahrt von Katherine in Richtung Westen, hat man Termiten nicht längst einen Architekturpreis verliehen? Mühelos kombinieren ihre bis zum Horizont reichenden, in einem feurigen Rot leuchtenden Siedlungen das Eckige mit dem Runden, das Filigrane mit dem Wuchtigen, das Gestreckte mit dem Steilen. Einige der meist mannshohen Bauten erinnern mit ihren Türmen, Erkern und Simsen an kunstvolle Kathedralen. Da es wohl kaum ein religiöser Impuls war, der die Insekten zu dieser Meisterleistung trieb, belegt ihr Werk, dass Erhabenes auch dem Instinkt entspringen kann.
Sogar dem Feuer, das plötzlich überall in der Hügellandschaft an unserem Highway lodert, halten die Behausungen stand. Wo der Wind in den ausgetrockneten Busch fährt, sprühen Funken auf, die wie irre gewordene Glühwürmchen vor uns her hüpfen. Die schwarzen Rauchschwaden, die in der Ferne aufsteigen, lassen auch unsere Fantasie schwarzmalen. Ist die Tatsache, dass uns seit einer halben Stunde nicht ein einziges Auto entgegenkam, eine Indiz für die Sperrung der Strecke? Auch die beiden Kolosse, die sich röhrend aus dem Rauch schälen, verschaffen keine Entspannung. Na klar, solche gigantischen Lastzüge packen das – aber wir?
Erst als wir die Trupps entdecken, die immer wieder ordnend an den Brandherden eingreifen, wird uns klar: Es handelt sich um gezieltes »Backburning«, eine von den Aborigines erfundene Methode, die verhindern soll, dass ein Feuer in der Hitze des Hochsommers vom Unterholz auf größere Flächen überspringt.
Ein paar Dutzend gedrungene Häuser und Hütten mit Parabolspiegeln auf den Dächern, ein »Bottle Shop«, auf dessen Parkplatz Aboriginefamilien die Alkoholration für den Abend verstauen, hier und da der rührende Versuch, einem Beet ein paar Blümchen abzuringen – das also ist Halls Creek, jenes Kaff, in dem die Temperatur im Sommer auf Grad klettern kann und das seine Bewohner in sarkastischer Selbstverachtung »Hell’s Crack« nennen. »Höllenloch«, bedeutet das frei übersetzt.
Die Nationalstraße Nummer eins, auf den ersten 5000 Kilometern unserer Recherchenreise unsere wichtigste Leitlinie, wird in diesem Abschnitt von einem Rudel streunender Köter beherrscht. Dringt, was nicht häufig vorkommt, ein fremdes Fahrzeug in ihr Revier, verwandeln sie sich in kläffende Furien.
Der Kampfhund, der sich vor dem Eingang unseres Motels ausgestreckt hat, befindet sich, gottlob, im Welpenalter. Tapsig schlägt er mit der Pfote immer mal wieder nach Kakerlaken, die seinen Attacken allesamt entkommen und selbst dann nicht in Gefahr geraten, wenn sie auf ihrer Flucht in den Swimmingpool fallen. Dessen Oberfläche deckt das faulige Laub eines ganzen Herbstes.
Mit Vierradantrieb ausgestattete Pritschenwagen vor den Zimmertüren verweisen auf die Stammgäste dieser Herberge: Handwerker, die in den nördlichen Randzonen des Bundesstaates Western Australia defekte Zäune, Stromleitungen, Kühlschränke oder Fernseher reparieren. Hin und wieder nächtigen hier auch Sozialarbeiter, die sich tagsüber abmühen, Aborigines bei der Gründung kleiner Betriebe zu unterstützen, und die abends beim Barbecue ihren Frust im Gesöff aus dem Sixpack und in Sturzbächen des Sarkasmus ertränken.
Nirgendwo anders in Australien, so ist aktuellen Medienreporten zu entnehmen, offenbart sich das Elend der Aborigines so drastisch wie in dieser Region. Als der Staat den Hilfeschrei der drangsalierten Frauen erhört und ein Alkoholverbot über die Siedlungen verhängt, formieren sich die Männer zu einer bizarren Demonstration. Auf Transparenten, die sie mitführen, heißt es: »Wir wollen trinken – jetzt!«
Soll man am Fuße des Kimberley-Plateaus an seinem journalistischen Ritual festhalten und sich beim Manager des Motels erkundigen, ob hier deutsche Auswanderer leben? Man befürchtet, dass man sich lächerlich macht mit einer solchen Frage – und stellt sie, wie die Goldsucher in dieser Gegend auf das unverhoffte Glück bauend, dann doch. »Unsere Küchenchefin ist Deutsche«, antwortet der Mann an der Rezeption. »Katja heißt sie. Heute hat sie frei. Aber morgen zum Frühstück ist sie wieder im Dienst.«
Die Küchenfee von Halls Creek trägt Schnürstiefel und hat einen Händedruck, der sie als gradlinig und durchsetzungsfähig ausweist. Die Botschaft, die von ihrem offenen Gesicht ausgeht, lautet: Ich kann ein Kumpel sein – aber wehe, das wird ausgenutzt! Ein Kurzhaarschnitt bändigt ihre dichten Locken. Das verleiht ihrer kräftigen Statur etwas Sportives. Man kann sie sich gut als Steuerfrau einer Rudermannschaft vorstellen, zunächst als lautstarke Antreiberin und dann mit Glückstränen auf dem Treppchen stehend – natürlich dem obersten.
Читать дальше