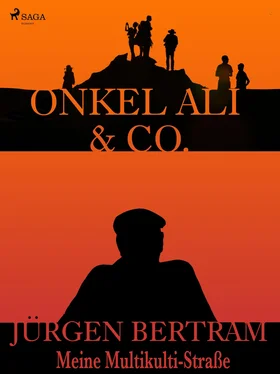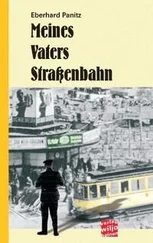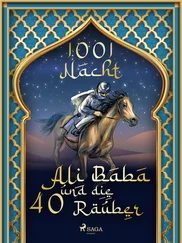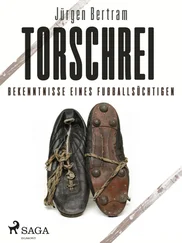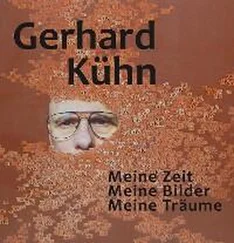Jürgen Bertram
Onkel Ali & Co.
Meine Multikulti-Straße
Mit »Protokollen« von
Helga Bertram
Saga
Braucht mein Auto neues Öl, bedient mich der algerische Tankwart. Die Rosen zum Geburtstag kaufe ich beim pakistanischen Blumenhändler, das Obst und das Gemüse beim Türken gleich nebenan, den Rollmops und den Heringssalat beim Fischhöker aus Vietnam.
Meinen Schoppen am Abend lasse ich mir in der griechischen Schenke kredenzen. Will ich meinen Gästen einen besonderen Tropfen bieten, berät mich der Weingrossist aus Chile. Und zu den Polizisten, die in meinem Viertel Streife gehen, gehören ein bosnischer und ein kurdischer Beamter.
Man sieht: das Prinzip Multikulti, das so mancher Politiker bereits für gescheitert hält, gehört zur alltäglichen Praxis in meiner ganz normalen Straße. Sie liegt im Hamburger Durchschnittsbezirk Eimsbüttel, ist etwa einen Kilometer lang und nach dem hanseatischen Heimatdichter Gustav Falke benannt.
So selbstverständlich leben in der Gustav-Falke-Straße Menschen mit dem unterschiedlichsten kulturellen Hintergrund zusammen, dass vor allem die Bürger mit nichtdeutschen Wurzeln eines der am meisten verkauften Bücher der vergangenen Jahrzehnte, nämlich Thilo Sarrazins Traktat »Deutschland schafft sich ab«, als Beleidigung empfinden.
Niemand von ihnen bestreitet, dass es in der Bundesrepublik islamische Eltern gibt, die ihre Töchter zur Heirat zwingen, oder libanesische Gangs in den Problemvierteln Berlins ganze Häuserblocks kontrollieren, dass der frühere Finanzsenator und Bundesbanker also punktuell richtig liegen mag mit seinen Befunden. Was sie aber in Rage bringt, ist die bereits in dem provokanten Titel anklingende und vom Stammtisch gierig aufgegriffene Behauptung, es handele sich um eine allgemeine, mithin existenzielle Gefahr.
Für mich, den nach 13 Korrespondenten-Jahren in Asien ins Herz von Hamburg zurückgekehrten Journalisten, war die Aufregung um dieses Buch eine Anregung – mich nämlich mit der Frage zu beschäftigen, welchen Einfluss Bürger mit einem »Migrationshintergrund« auf das gesellschaftliche Leben in meinem Quartier ausüben und was sie auf sich nahmen, als sie ihre Heimat aus ökonomischen oder politischen Gründen verließen. Menschen, mit denen mich bisher ein Hallo-wie-geht’s-Verhältnis verband, lernte ich bei meinen Recherchen also endlich kennen.
Da die Straße, in der ich wohne, auch in den unauffälligeren Bezirken von Berlin, Frankfurt, Köln oder Hannover liegen könnte, sind meine Erfahrungen, wie ich glaube, repräsentativer als Thilo Sarrazins Thesen. Aufklärung, aber keine Verklärung – so lautet das Ziel meines Spaziergangs durch die Kulturen, zu dem ich den Leser einlade.
Dass ich mich nicht auf die von Thilo Sarrazin fokussierten Familien mit islamischem Hintergrund beschränke, hat einen einfachen Grund: Auch die Chilenen oder Griechen in meiner Umgebung empfinden sein Buch als Rundumschlag gegen »die Ausländer«. In einigen Fällen erzählen die Protagonisten ihre Geschichte in der Ich-Form. »Protokolle« nennt man diese literarische Variante, die aus den Extrakten langer Interviews besteht. Meine Frau Helga Bertram hat sie aus Tonbandaufzeichnungen zusammengestellt.
Hamburg, im Herbst 2011
Jürgen Bertram
I Eine anatolische Saga
1 »Hier bin ich, Mölln!«
Hüseyins Traum
Wovon träumt ein Hirte, der auf den Höhen Ostanatoliens für einen Hungerlohn Schafe hütet? Von einem Trecker träumt er, von einem dieser bulligen Gefährte, die, den Pflug im Schlepp und in eine Wolke aus Staub gehüllt, unten im Tale des Euphrat über die Äcker tuckern. Wie Musik, Zukunftsmusik, klingt das monotone Geräusch der Maschine in seinen Ohren. Denn einen Trecker zu besitzen, bedeutet: sein eigener Herr sein.
Aber wer sich Ende der sechziger Jahre selbständig machen will in dem Provinznest Erzincan, der muss seiner türkischen Heimat erst einmal den Rücken kehren und sich in das ferne Land begeben, in dem die Schlote rauchen, die jungen Frauen Minirock tragen und die Studenten einen Revolutionär namens Ho Chi Minh hochleben lassen.
Von Erzincan juckelt der Sohn, Ehemann, Bruder, Vater und Onkel mit dem Bus ins knapp zweitausend Kilometer entfernte Istanbul. Dort steigt er in den Zug nach München und anschließend in den nach Hamburg. Mit dem Lastwagen geht es noch einmal in Richtung Norden.
Vier Tage und vier Nächte dauert die Reise in die kleine Stadt in Schleswig-Holstein, in die eine Agentur in Istanbul den anatolischen Gastarbeiter vermittelte und für deren Finanzierung er sich bei seiner Verwandtschaft hoch verschuldete. Hier bin ich, Mölln! Ich, der Hirte Hüseyin Yldirim aus Erzincan – Ende zwanzig, acht Geschwister, drei Kinder, fünf Jahre Grundschule, kein Wort Deutsch, nichts gelernt, aber strotzend vor Kraft, Arbeitskraft.
Am liebsten würde sich Hüseyin Yldirim gleich nach seiner Ankunft, einem Freitag im Frühling, seinen Platz in der Gießerei ansehen, die ihn für zunächst zwei Jahre unter Vertrag nimmt. Aber der Betrieb ruht. Wie? Freitags arbeiten die Deutschen nicht? Hieß es in der Türkei nicht, sie seien so fleißig? Am Montag darauf regt sich immer noch nichts in der Firma. Und auch die Bäckereien, die er, mit seinen zwanzig Mark Begrüßungsgeld in der Tasche, in der Fußgängerzone des Kurortes abklappert, bleiben geschlossen. Was der Moslem nicht weiß: In der Bundesrepublik begeht man gerade eines der wichtigsten christlichen Feste. Von Karfreitag bis Ostermontag dauert es.
So häufig hat der Hirte, der auszog, um sich in Deutschland den Traum vom eigenen Trecker zu erfüllen, seiner Tochter Fetiye über seine ersten Tage in Mölln berichtet, dass es ihr nicht schwer fällt, uns die Geschichte bei türkischem Gebäck und Tee in allen Einzelheiten weiter zu erzählen. Fetiye gehört zu unseren Nachbarn in der Gustav-Falke-Straße in Hamburg-Eimsbüttel, einem Bezirk, der weder zu den sozialen Brennpunkten noch zu den Flaniermeilen der Schickeria gehört. In der gesellschaftlichen Mitte ankert er.
Mit ihrer Liebe zum Detail erweist sich unsere Nachbarin vom Haus Nummer 10 als Glücksfall für die Erkundungen in unserer Straße und ihrer unmittelbaren Umgebung. Denn vor allem im Alltag, in den Irritationen und Frustrationen, Erfolgen und Misserfolgen, Brüchen und Durchbrüchen, spiegelt sich eine Migranten-Existenz und nicht in Statistiken, Verordnungen oder gar biologistischen Thesen.
Am Dienstag nach Ostern wird also wieder gearbeitet in der Möllner Gießerei. Und als seine deutschen Kollegen ihm »Mahlzeit« zurufen, bedeutet das für den Arbeiter aus dem Osten Anatoliens: Endlich gibt’s wieder etwas Handfestes zu essen. Aber was ist das für Fleisch, das in der kleinen Kantine serviert wird? Lamm? Huhn? Kalb? Es könnte, da sich eine undefinierbare Masse auf dem Teller häuft, auch Schweinefleisch dabei sein. Und Allah, der Gott und Richter am Jüngsten Tag, verbietet dessen Genuss. Also: Finger davon lassen! »In seiner ersten Woche in Mölln«, berichtet Fetiye, die Tochter, »hat mein Vater aus Angst, er könnte gegen den Koran verstoßen, fast nur Brot gegessen – Brot und manchmal ein Ei dazu.«
Mit seiner Unterkunft, einem Raum mit sechs Betten, kommt der ostanatolische Gastarbeiter besser klar. Weil er mit leichtem Gepäck anreiste, benötigt er nicht viel Platz. »Sein Koffer«, erzählt seine Tochter, »war so klein, dass er gerade für ein wenig Proviant und die Unterwäsche ausreichte. Die Hose, die mein Vater an hatte, war die einzige, die er besaß. Und seine beiden einzigen Hemden trug er übereinander am Körper. Es herrschte eben extreme Armut bei uns auf dem Land.«
Zwischen fünfzig und sechzig Mark in der Woche zahlt die Gießerei ihrem türkischen Mitarbeiter. Das ist eine Menge Geld für einen Hirten, der vor seinem Aufbruch nach Deutschland heiratete und einen Sohn und zwei Töchter zu versorgen hat. Eines der Mädchen ist Fetiye, unsere heutige Nachbarin. Für sich selbst gibt Hüseyin Yldirim so gut wie nichts aus in Mölln. Umso mehr schmerzt es ihn, dass für jede Nutzung des gemeinschaftlichen Waschraums eine Mark fällig wird. Seine Überweisungen in die Türkei beschränkt er auf wenige Male im Jahr. Auf diese Weise reduziert er die Gebühren auf ein Minimum.
Читать дальше