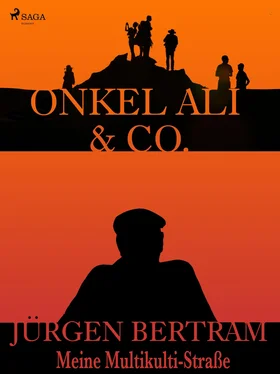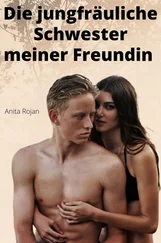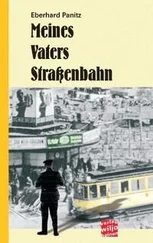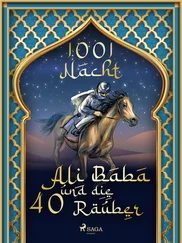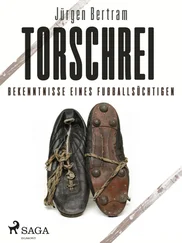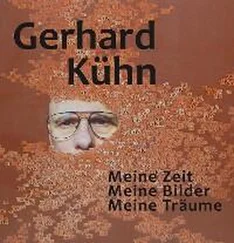Passt die Violine, die ihm seine Eltern schenkten, also besser zu ihm, als der vom Schnee durchweichte Lederball, den er, das Gesicht gerötet von Kälte und Anstrengung, gerade seinem Gegner abgrätscht? Fetiye, seiner Mutter, kann ich diese, dem rauen Ambiente eines Trainingsgeländes angemessene Frage nicht stellen. Sie ist noch immer nicht erschienen. Beren, ihre Tochter, klärt mich auf. Ihre Mutter suche seit einer halben Stunde einen Parkplatz. Deswegen verspäte sie sich. Nur deswegen. Wirklich.
Mir ist klar, was Fetiye, unserer aus Ostanatolien stammenden Nachbarin, in diesem Moment durch den Kopf geht: Die Deutschen gelten als die pünktlichsten Menschen der Welt. Wenn wir von ihnen anerkannt werden wollen, müssen wir Türken besonders pünktlich sein. Und wenn wir es mal nicht sind, bedarf es einer plausiblen Begründung.
Nicht unangenehm auffallen, sich anpassen, das Vorurteil durch die Praxis widerlegen – es ist nicht das erste Mal, dass ich bei einer beruflichen Begegnung mit Bürgern türkischer Herkunft auf diese Haltung stoße. Als ich in den siebziger Jahren mit einem TV-Team des Norddeutschen Rundfunks ein niedersächsisches Dorf porträtiere, in dem bereits mehr Türken als Deutsche leben, lassen uns die deutschstämmigen Bewohner häufig warten, während uns die Gastarbeiter mit ihrer Überpünktlichkeit beeindrucken. Das gilt auch für den Zustand ihrer Wohnungen, den Türken bis heute gern mit einem Begriff bezeichnen, den sie der italienischen Sprache entliehen: picobello.
Natürlich kann man aus solchen Beobachtungen keine repräsentativen Schlussfolgerungen ziehen. Doch belegen sie einmal mehr, in welchem Maße sich die Realität von der im Unterbewusstsein gespeicherten Erwartung unterscheiden kann.
Fetiye sucht noch immer einen Parkplatz, ihr Sohn, der ihr mit seiner Schwester Beren vorauseilte, sprintet im Trikot seines Lieblingsvereins HSV über den Trainingsplatz: Es bleibt mir in diesem Recherchen-Vakuum nichts anderes übrig, als mich mit Beren zu unterhalten, die mit sichtlicher Erleichterung registriert, dass ich Verständnis habe für die Verspätung ihrer Mutter. Was, um Himmels willen, soll man ein gerade mal sechsjähriges, in der Abendkälte bibberndes türkisches Mädchen fragen? Wie es ihm in Deutschland gefällt? Was es vergangenen Sommer bei seinem Besuch im Osten Anatoliens empfunden hat? Nicht kindgerecht genug, sage ich mir – und stelle in meiner Verlegenheit eine Frage, die so linkisch klingt, dass ich erschrecke: »Hast Du schon einen Berufswunsch?«
Beren erlöst mich, indem sie mit fester Stimme antwortet: »Ja.«
»Und was willst du werden?«
»Bundesliga-Schiedsrichterin.«
»Wie kommst du denn da drauf?«
»Neulich hat Beritan mit anderen Jungen auf der Wiese am Weiher Fußball gespielt. Weil sie keinen Schiedsrichter hatten, haben sie mich gefragt, ob ich das machen will. Na, ja: Und als das Spiel aus war, haben sie gesagt: Du warst gerecht.«
»Hattest du denn eine Pfeife?«
»Nein. Wenn mir etwas nicht gefiel, dann habe ich Laute von mir gegeben – bei Abseits: ›Huuuu‹, bei einem Foul: ›Heeee‹.«
Berens Mutter spürt man, als sie endlich auf dem ETV-Gelände eintrifft, noch die Anspannung an, die das Bewerbungsgespräch im katholischen Gymnasium mit sich brachte und die nun in den Stress der Ungewissheit mündet. Nach dem Taufschein ihres Sohnes habe man sie gefragt. War das ernst gemeint? War es Ironie?
Ein aus einer deutschen Familie stammenden Anwärter hat auf die Frage, warum er unbedingt nach Sankt Ansgar wolle, geantwortet: »Weil ich mit Beritan zusammenbleiben will. Beritan ist mein bester Freund.« – Könnte das als Kumpanei ausgelegt werden, die an einer auf Höchstleistung gepolten Schule unerwünscht ist? Gehört, andererseits, der Zusammenhalt nicht zu den christlichen Werten?
»Vergiss den Teig nicht!«, ermahnt Fetiye eine die Dribblings ihres Sohnes beobachtende deutsche Mutter. »Und denk du an das Waffeleisen!«, erwidert die junge Frau. »Auch das Backpulver dürfen wir nicht vergessen«, fügt sie hinzu.
Plötzlich erfasst mich eine irritierende Überlegung: Du hast während deiner Jahre als Fernsehkorrespondent über Bürgerkriege, Volksaufstände, Erdbeben und Feuersbrünste berichtet. Du hast Präsidenten interviewt, Kanzler und Künstler. Du hast Dokumentationen auf dem Himalaya gedreht, auf den südpazifischen Atollen, im australischen Outback, am Gelben Meer. Und nun notierst du dir auf diesem Trainingsgelände in Hamburg-Eimsbüttel hektisch, fast schon übereifrig, die banalsten Dialoge. Hast du die journalistischen Maßstäbe verloren? Keineswegs, beruhige ich mich. Denn indem die beiden aus so unterschiedlichen Verhältnissen stammenden Frauen sich völlig unverkrampft über Alltägliches verständigen, verkörpern sie nichts Geringeres als den Idealzustand interkulturellen Zusammenlebens: die Normalität. Und sie ist ein Wert, den auch ich als Journalist häufig unterschätzt und ignoriert habe.
Spätestens am kommenden Freitag, also in vier Tagen, trifft das Elitegymnasium, wie man Fetiye mitteilte, seine Entscheidungen. Eltern, deren Kind den Sprung nach Sankt Ansgar nicht schafft, erhalten bis zum Abend dieses Tages telefonisch Auskunft. Die Auserwählten werden in der Woche danach per Brief informiert. Es ist ein Verfahren, das an den Nerven zerrt – auch an meinen.
Freitag, 28. Februar, vormittags. Fetiye schüttelt den Kopf, als ich sie an ihrem Stand frage, ob sich das Direktorium von Sankt Ansgar schon gemeldet hat. »Gott sei Dank, nicht. Normalerweise freut man sich ja über einen Anruf. Aber heute schrecke ich jedes Mal zusammen, wenn das Telefon klingelt.«
Freitagnachmittags. Das Telefon klingelt. Wenn das Sankt Ansgar ist, bedeutet das: Es wird nichts mit der Eliteschule. Bevor sie den Hörer abnimmt, beruhigt Fetiye sich (und mich) mit vorauseilendem Trost: »Bei diesem Zeugnis gibt es für Beritan genügend Alternativen. Es muss ja nicht eines der besten Gymnasien Hamburgs sein.« Aber nicht Sankt Ansgar ruft an, sondern eine Kundin, die eine Bestellung aufgibt.
Freitag, früher Abend: das Telefon ruht, gleichzeitig Hoffnung und Ängste verbreitend, in seiner Fassung. Zwei, maximal drei Stunden noch – dann wird Feierabend sein in Sankt Ansgar. Aber kann man denn automatisch mit einer Zusage rechnen, wenn bis heute Abend keine Absage eintrifft? Ich lenke Fetiye ab, indem ich eine Informationslücke fülle. Was ist eigentlich aus ihrem Vater geworden, dem Hirten, der auszog, um seinen Traum vom eigenen Trecker zu verwirklichen?
Hüseyin Yldirim kehrt Ende der neunziger Jahre, also drei Dekaden nach seinem Aufbruch nach Deutschland und sechs Jahre nach einem verheerenden Brandanschlag auf ein von Türken bewohntes Haus in Mölln, zurück in den Osten Anatoliens. In seinem Heimatstädtchen Erzincan bezieht er mit seiner Frau eine kleine Wohnung und holt, aus reiner Freude am Lernen, die Realschulreife nach. Als er an Leberkrebs erkrankt, entschließt er sich zu einer Transplantation. Im Hamburger Universitätskrankenhaus, wo man auch seiner Tochter das Leben rettete, begibt er sich in die Obhut der Ärzte. Seine Verwandtschaft beruhigt er mit einer schlichten Gleichung: Ich war in Deutschland immer fleißig und ehrlich, nun wird Deutschland gut zu mir sein. Der Chirurg, der ihn erfolgreich behandelt, sagt: Es ist auch dieser Optimismus, der ihn geheilt hat.
Und der Trecker? Was wurde aus dem Trecker?
»So richtig benutzt«, sagt Fetiye, die noch immer auf das Telefon starrt, »hat mein Vater ihn nie. Aber weggeben wollte er ihn auf keinen Fall. Als mein Onkel den Trecker mal im Sommer benutzte, hat er ihm den Schlüssel wieder weggenommen. ›Du behandelst ihn nicht gut genug‹, hat er ihm vorgeworfen.«
»Und wo steht der Trecker jetzt?«
»In einer Hütte, die mein Vater extra für ihn gebaut hat. Manchmal macht er die Tür auf, sieht sich den Trecker an und macht die Tür wieder zu.«
Читать дальше