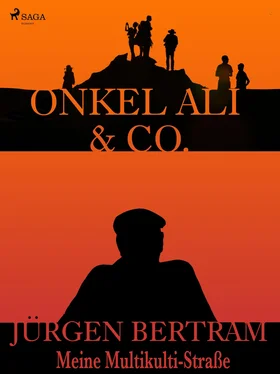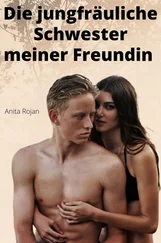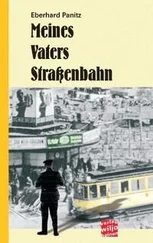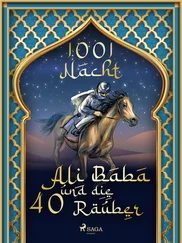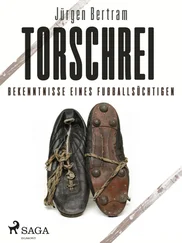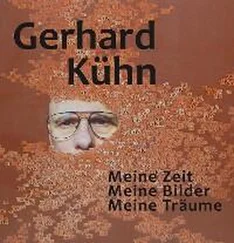»Wird er ihn eines Tages verkaufen?«
»Nie. Wir überlegen jetzt schon, wer in unserer Familie würdig genug ist, um ihn eines Tages zu erben.«
Dienstag, 1. Februar, Fetiyes Geburtstag. Gegen zwölf Uhr mittags – high noon in der Gustav-Falke-Straße – parkt der Briefträger sein Fahrrad vor dem Obst- und Gemüseladen. Beim Offnen des Umschlags, den er ihr überreicht, zittern Fetiye die Hände. Gymnasium Sankt Ansgar steht auf dem Briefkopf. Fetiye liest, liest, liest – und hebt den Daumen. Beritan hat es geschafft.
Freitag, 13. Mai 2011. Fetiye und ihr Mann Önder bitten mich, als ich, voll bepackt mit Tüten und Taschen, aus dem U-Bahnschacht meiner Wohnung zustrebe, in ihren Laden. »Wir haben ein Problem«, sagt meine Nachbarin. »Vielleicht können Sie uns helfen.«
Ist den Kindern etwas passiert? Wollen sich die türkischen Eheleute, was für mich zumindest eine inhaltliche Katastrophe wäre, zurückziehen aus meinem Buchprojekt? Brauchen die beiden einen Kredit für ihr Geschäft? Bevor ich mich der nächsten Hiobs-Variante ausliefere, erlöst mich Fetiye, indem sie ihrer Erklärung ein Lächeln vorausschickt, das mütterlichen Stolz signalisiert. »Vor wenigen Minuten«, sagt sie, »hat ein Jugendtrainer des HSV bei uns angerufen.«
»Und was wollte er?«
»Er hat gesagt, dass er Beritan schon seit längerer Zeit beobachte und dass er vor allem von seiner Laufstärke beeindruckt sei. Aus diesem Potential könne man etwas machen.«
»Und werden Sie darauf eingehen?«
»Wenn wir das tun, bedeutet das: Beritan muss dreimal die Woche jeweils zwei Stunden draußen am Stadtrand trainieren und sich fast jedes Wochenende für ein Turnier bereithalten. Na ja, und die katholische Schule, auf die er nun wechselt, stellt auch höchste Anforderungen an ihn. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen ...«
»Was glauben Sie: Wie würde er sich selbst entscheiden?«
Fetiye, die ins Zentrum eines Hochleistungs-Konfliktes geratene türkische Mutter, gibt ihre Antwort mit den Augen. Natürlich würde Beritan sofort bei seinem Lieblingsverein trainieren, sagt ihr Blick. Und mit der Ratlosigkeit, die danach aus ihren Gesichtszügen spricht, nimmt sie mich, den Nachbarn, Kunden, Autor und Fußballfan, in die Pflicht.
Eingerahmt von Apfelsinenkisten, Flaschenbatterien und Gemüsezwiebeln philosophiere ich an diesem lauen Nachmittag im Mai mit deutscher Tiefgründigkeit vor mich hin: »Wem der Schöpfer, sei es Allah, Buddha oder der Zufall, ein ganz besonderes künstlerisches oder sportliches Talent in die Wiege legte, der ist verpflichtet, es zu nutzen – und zwar nicht nur zur eigenen Erbauung, sondern auch zum Segen der Gesellschaft.«
»Haben Sie einen konkreten Vorschlag?«, fragt mich Fetiye mit spürbarer Ungeduld.
»Versuchen Sie es! Versuchen Sie, herauszufinden, ob sich Schule und Fußball miteinander vereinbaren lassen.«
Samstag, 14. Mai 2011. Es ist der letzte Spieltag einer Bundesliga-Saison, die der große HSV mit einem enttäuschenden Platz im Mittelfeld und der Erkenntnis beendet, die Nachwuchsarbeit zu intensivieren und den Fokus verstärkt auf die ehrgeizigen Söhne von Migranten zu richten. »Na, haben Sie sich entschieden?«, frage ich Önder, den Vater des laufstarken Fußballers.
»Gestern Abend hat sich noch mal der Trainer vom HSV bei uns gemeldet und uns dringend gebeten, unseren Sohn zum Training zu schicken. Wir haben zugesagt.«
Und wie ist das mit der Violine? Wird Beritan unter den neuen Bedingungen auf diesem Instrument weiter üben?«
»Nein, damit wird er aufhören. Aber ...«
»Aber?«
»Er wird Klavierunterricht erhalten – wie seine Schwester Beren.«
Montag, 30. Mai. Als ich am frühen Abend auf dem Mittelstreifen der Gustav-Falke-Straße meine Walking-Übung absolviere, stoppt Fetiye, unsere Nachbarin von der Hausnummer 10, ihren VW-Bus neben mir. Sie kurbelt das Fenster herunter und sagt: »Ich habe einen Anschlag auf Sie vor.«
»Nur zu.«
»Ich komme gerade mit Beritan vom Konditionscheck zurück. Der Trainer beim HSV meint, was die Ausdauer betrifft, müsse er noch einiges zulegen. Sie walken doch fast jeden Tag. Hätten Sie etwas dagegen, wenn er in Zukunft neben Ihnen herläuft?«
Ich sage zu. Schließlich war der HSV während meiner Kindheit auch mein Lieblingsverein.
5 »Mein Mund stand zwei Meter weit auf«
Arif, der Einsame
Es lärmt tagsüber fast ununterbrochen, wenn, wie bei uns im Haus Gustav-Falke-Straße Nummer 4, Handwerker die gesamte Fassade renovieren. Mal gibt der Bohrer den durch Mark und Bein gehenden Misston an, mal die Motorsäge, mal der Hammer. Aber das Scheppern, das an einem Winternachmittag die ohnehin schon genervten Bewohner aufschreckt, übertrifft diesen Pegel noch.
Ich reiße die Tür zum Flur auf und blicke auf einen Knaben, der völlig perplex inmitten einer mit Scherben übersäten Pfütze steht. Statt die zwei Kisten Mineralwasser, die ich telefonisch im türkischen Lebensmittelladen an der Ecke bestellt habe, nacheinander in unsere Speisekammer zu schleppen, wollte er sie offenbar mit einem Male wuppen – eine, wie man unschwer erkennen kann, folgenschwere Selbstüberschätzung.
Ich denke: Wenn der Besitzer des kleinen Geschäftes in unserer Straße von dem Malheur erfährt, zieht er seinem minderjährigen Gehilfen den Schaden vom Lohn ab, und womöglich, man weiß ja nie, fällt die Strafe noch härter aus. Also biete ich dem Knaben an, die Fracht trotz des Bruchs zu akzeptieren und den vollen Preis dafür zu zahlen. Und obwohl sie in seinen Ohren wie Hohn klingen könnte, tröste ich ihn mit einer deutschen Alltagsweisheit: »Scherben bringen Glück«.
Der Junge lehnt mein Angebot ab und kehrt kurz darauf mit zwei neuen Kisten zurück. Wie sein Chef reagiert habe, frage ich ihn. »Genau so wie Sie. Mein Vater hat gesagt: ›Scherben bringen Glück‹.« In diesem Moment weiß ich, dass der türkische Lebensmittelladen in meiner Straße ein Familienbetrieb ist und dass es sich lohnt, mit dem nachsichtigen Patriarchen mal näher ins Gespräch zu kommen.
Auch Arif Sarikaya, Jahrgang 1966, stammt aus dem Osten Anatoliens. Das 250-Seelen-Dorf Sütpinar, in dem er aufwächst, liegt nur wenige Kilometer von der Bezirkshauptstadt Erzincan entfernt, der Heimat seiner Verwandten Fetiye und Önder. Es kommt häufig vor, dass sich, nachdem es ein Onkel oder ein Schwager in Deutschland zu einem gewissen Wohlstand brachte, ganze Sippen aufmachen in Richtung Norden, um sich auch dort wieder zu Familienclans zusammenzuschließen.
Nur mühsam kann Arif an manchen Stellen die Tränen unterdrücken, als er mir in seinem Geschäft die Geschichte seiner Kindheit erzählt. Als er geboren wird, verdingt sich sein Vater in Istanbul als Hilfsarbeiter. Arif ist fünf, als sein Vater einem seiner Brüder in die Bundesrepublik folgt. In Hamburg heuert er bei der Bundesbahn an und spezialisiert sich auf das Auswechseln von Batterien. Ein gewaltiger Aufstieg ist das für einen Mann, der im Hafen der türkischen Metropole Kohlesäcke von den Schiffen hievte.
Unter den Kindern im fernen Sütpinar herrscht in der Zeit des großen Exodus helle Aufregung, wenn sich am anatolischen Himmel mal eine der kleinen Sportmaschinen zeigt. Sie versammeln sich dann, wie Arif aus diesen Tagen berichtet, auf dem Dorfplatz und beten: »Ucak, ucak babami bana getir!« – »Bitte, bitte, Flugzeug«, heißt das auf Deutsch, »bring uns unsere Väter zurück.«
Einige Male kommt der Vater tatsächlich zurück – aber nur auf Besuch. »Ja, ich habe mich nach ihm gesehnt«, erinnert sich Arif. »Aber wenn er dann plötzlich da war, dann habe ich mich vor ihm versteckt. Ich kannte meinen Vater ja nicht. Mein Opa war mein Vater.«
Erst die Tafel »Milkana«, die der fremde Mann aus Hamburg mitbrachte, lockt seinen Sohn etwas aus der Reserve. »Es war plötzlich ein ganz anderer Geruch im Raum, wenn mein Vater ihn betrat. Nach Ausland roch es, nach Stadt. Ich mochte diesen Geruch. Aber wenn ich mich daran gewöhnt hatte, reiste mein Vater auch schon wieder ab.«
Читать дальше