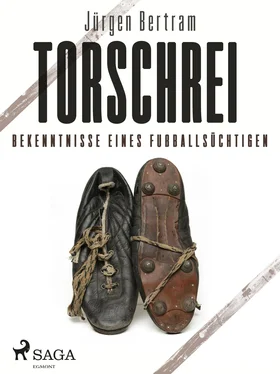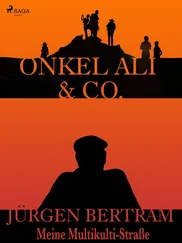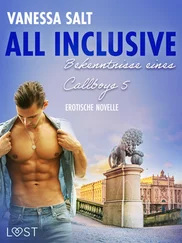Jürgen Bertram
Torschrei
Bekenntnisse eines Fußballsüchtigen
Mit einem Nachwort von Günther Koch
Saga
Für Kurt (»Todos«) Brandt, SV Viktoria Bad Grund,
mein Vorbild als Torwart
Vergangenen Herbst, als der Wind im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel die Straßenbäume schüttelte, überkam es mich wieder. Die Kastanie, die beim Sonntagsspaziergang unmittelbar vor mir aufprallte, kickte ich mit dem rechten Spann zielgenau zwischen die eisernen Streben einer U-Bahn-Überführung. Ich riss die Arme hoch und schrie: Tooor! Mein Gott, so sagten die Blicke der anderen Passanten, der ist längst ergraut und immer noch ein Kindskopf!
Meinem fußballerischen Reflex folgte die Reflexion. Sie gipfelte in der Erkenntnis, dass meine Besessenheit, gegen alles zu treten, was sich vor meinen Füßen bewegt, und an jedem Sportplatz innezuhalten, auf dem zwei Mannschaften einem Ball hinterherlaufen, in einer Zeit wurzelt, in der ich tatsächlich noch ein Kind war. Als Adenauer-Ära ging sie in die Geschichtsbücher ein – und dass der Fußball damals mein Ein und mein Alles war, hat auch mit der Gefühlskälte zu tun, die ich in meinem kleinbürgerlichen Elternhaus erlebte und die charakteristisch ist für diese von Kriegslast und Aufbruch gleichermaßen geprägte Epoche.
Als ich mich noch an diesem denkwürdigen Herbsttag zu einem Buch über meine Fußballsucht und ihre familiären wie gesellschaftlichen Hintergründe entschloss, ahnte ich noch nicht, in welche Wechselbäder der Emotionen ich mich beim Schreiben stürzen würde. Ich staunte über die kriminelle Energie, mit der ich mich dem von meinem autoritären Vater verhängten Fußballverbot entzog. Und ich erschrak, als mir bewusst wurde, dass sich mein Suchtverhalten keineswegs auf den Fußball beschränkte und ich nur mit großem Glück dem Absturz in die Verwahrlosung entging.
Ich wunderte mich, wie langfristig vor Jahrzehnten erlittene Beschädigungen nachwirken, aber ich schwamm auch in Glückseligkeit, als ich noch einmal die Höhepunkte meiner Laufbahn als Fan und als Spieler Revue passieren ließ: die Tramptouren zu den internationalen Arenen, die Begegnungen mit meinen Idolen, die Schlammschlachten auf den Plätzen der niedersächsischen Provinz, meine eigenen Heldentaten als Torwart.
Was mich am meisten verblüffte, war die Detailgenauigkeit, mit der ich mich, unterstützt durch intensive Recherchen in Zeitungsarchiven und Reisen zu wichtigen Schauplätzen, an meine ersten Fußballerlebnisse in den Harzer Bergbauzentren Bad Grund und Goslar und an andere Schlüsselszenen meiner Kindheit und Jugend erinnern konnte. Das erleichterte mir die Entscheidung, diese Erlebnisse aus der Sicht des staunenden, hin und her gerissenen Knaben nachzuerzählen. So romanhaft und dramatisch einige Szenen auch wirken mögen: Alles, was ich beschreibe, hat sich so oder zumindest so ähnlich zugetragen. Verändert habe ich lediglich einige Namen.
So entstand ein Text, der von Flanken und Fallrückziehern, Stars und Stadien, Ecken und Elfmetern handelt und sich als Hymne auf den Fußball versteht, aber eben auch eine in einer bleiernen Zeit angesiedelte Familiengeschichte erzählt. Natürlich habe ich mich vor allem bei den sehr persönlichen Passagen gefragt: Wie weit kann ich gehen? Ich entschied mich, da Halbherzigkeit und Schönfärberei miserable inhaltliche und dramaturgische Fundamente sind, für die Offensive. Und dies hatte, um einen anderen Begriff aus der Fußballsprache zu verwenden, am Ende die Wirkung eines Befreiungsschlages.
Die Bürger der alten Kaiserstadt Goslar möchte ich bitten zu bedenken, dass ich die Atmosphäre in den fünfziger Jahren beschreibe. Ich bin mir sicher, dass am Fuße des Harzgebirges heute – wie in der gesamten Bundesrepublik – ein offeneres und toleranteres Klima herrscht.
I
Schweigen. Auch am Sonntag beim Frühstück: dieses grauenhafte Schweigen. Meine Mutter schweigt, weil sie ständig an ihre Eltern, meine Oma und meinen Opa, denkt. In Berlin, im Stadtteil Wedding, kamen sie, kurz vor Toresschluss, bei einem Bombenangriff ums Leben.
Mein Vater schweigt, weil er in Gedanken bestimmt schon wieder bei seiner Arbeit im Wald ist: Die Axt anlegen. Den Stamm spitzen. In Deckung gehen. Die Äste entfernen. Aufpassen, dass kein Vogelnest beschädigt wird. Den Stamm in Stücke sägen.
Ein Jahr lang muss mein Vater, der vor dem Krieg als Buchhalter der Erzgrube »Hilfe Gottes« in Bad Grund im Oberharz hinter einem Schreibtisch saß, im Wald arbeiten. Das ist die Strafe dafür, dass er einem Mann folgte, der auf den Briefmarken in der Schublade einen Schnurrbart trägt und den die Erwachsenen »Adolf« nennen. NSDAP, SA, Oberscharführer … mit den Begriffen in dem Fragebogen, mit dem sich mein Vater wochenlang beschäftigt hat, kann ich nichts anfangen. Aber sie bedeuten wohl etwas Böses.
Der ältere Bruder meines Vaters, mein Onkel Ernst, ist im Krieg gefallen. In der Eifel. Am 13. Februar fünfundvierzig. Auch kurz vor Toresschluss. Gefallen? Kann man nicht wieder aufstehen, wenn man gefallen ist? Nebenan schimpft der alte Bartels mit seiner Frau. Wenn sie zurückschimpft, jault Molli auf, der schwarze Spitz der beiden. Der Himmel ist grau, dunkelgrau – wie gestern und vorgestern und vorige Woche und die Woche davor. Die Uhr an der Wand tickt, tickt, tickt. Bitte, sagt was; irgendwas. Meine Eltern sagen nichts.
Ich renne vom Roland, dem Hügel, auf dem wir wohnen, in Richtung Kurpark, streife die Sträucher der Schrebergärten, in denen Mokri haust, der Italiener, der, wie die Leute erzählen, unsere Katzen wegfängt und brät oder kocht oder dünstet oder gleich roh verzehrt und der mit seiner Flinte auf die Vögel schießt, die im Liederbuch meiner Volksschulklasse 1a vorkommen. Amsel, Drossel, Fink und Star. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle .
Der »schöne Erich«, ein Kriegskamerad meines Vaters, sagt: Wenn die Italiener nicht so feige gewesen wären, dann hätten wir den Krieg noch gewonnen. Anschließend erzählt er immer einen Witz. »Fragt der eine: Kennst du Italiener? – Antwortet der andere: Ja, aber nur flüchtig.« Auch der schöne Erich war irgendwo Mitglied. Nur aus einem doppelten Buchstaben besteht der Name: SS.
Auf dem Iberg, wo die Sage vom Zwergenkönig Hübich spielt, der einer armen Bergmannsfrau silberne Tannenzapfen schenkte, knarzen die Buchen im Novemberwind. Seltsame Laute weht er aus dem Teufelstal zu mir herauf: Uuiiii. Pfuuiiii. Aaaaah. Als eine Lichtung den Blick freigibt, erkenne ich ein rechteckiges, von Pfützen übersätes Feld, auf dem Pulks junger Männer, deren Konturen immer wieder hinter einem Schleier aus Schneeregen verschwimmen, einen Ball vor sich hertreiben.
Ich stolpere, rutsche, springe den Hang hinunter. Kaum bin ich am Rande des Platzes zum Stehen gekommen, fliegt der klitschnasse Lederball wie ein Geschoss auf mich zu. Aus Angst, er könne unmittelbar vor mir aufprallen und mir mitten ins Gesicht klatschen, stoppe ich ihn mit dem linken Fuß und halte ihn wie ein waidwundes, aber keineswegs erledigtes Wild für fünf, sechs Sekunden unter der Sohle fest. Dann hebe ich ihn auf und werfe ihn einem der keuchenden Männer in den kurzen Hosen zu. Der leitet ihn, ein knappes »Danke!« knurrend, an einen Mitspieler weiter. Er läuft, dreht sich, zielt, trifft. Toooor!, rufen die Zuschauer und umarmen sich.
Ich – jawohl: Ich – habe die Aktion eingeleitet, die mit Triumph und Jubel endete. Ein Schauer des Glücks erfasst mich. Ich speichere mein Erlebnis in allen Einzelheiten im Kopf, bewahre es dort auf wie einen Schatz.
Mir ist klar, dass ich mich heute Vormittag unerlaubt von zu Hause entfernt habe. Also erwartet mich nach meiner Rückkehr eine Strafe. Um die Begegnung mit meinem Vater hinauszuzögern, erfinde ich Spiele. Ich spiele Fußball mit mir selbst.
Читать дальше