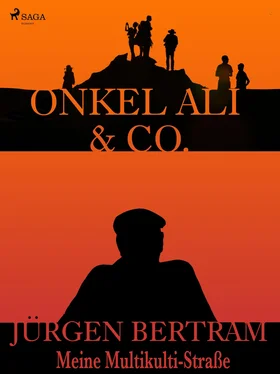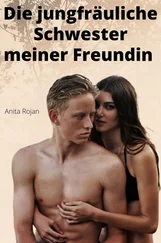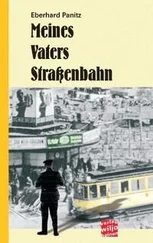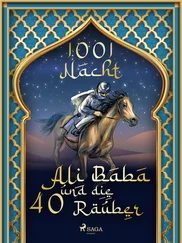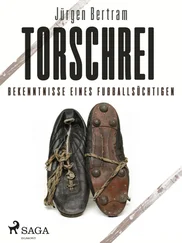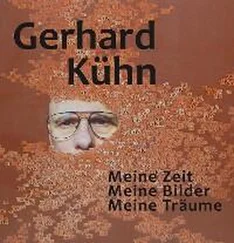Ein letzter Schluck, eine letzte Geschichte. Von Boris Becker handelt sie, der sich, als er vor Schmerzen nicht mehr weiterwusste, in seine Obhut begab. Unter einem Dehn-Defekt habe der Tennisstar gelitten.
Fröhlich vor sich hin pfeifend, fegt ein Bediensteter der Stadtreinigung zwischen dem U-Bahn-Schacht und dem Laden den Staub zusammen. »Ein Landsmann von mir«, sagt Önder. »Der war mal ganz oben, hat als Geschäftsmann sehr viel Geld gemacht. Dann hat er sich verspekuliert – und nun ist er ganz unten. Aber er steckt das weg, beklagt sich nicht. Davon könnten die Deutschen einiges lernen.«
»Sind die Deutschen zu pessimistisch?«
»Ja. Das sind sie. Die Deutschen könnten stolz sein auf ihren Staat, der zu den besten der Welt gehört. Aber stattdessen beklagen sie sich darüber, dass sie zu viel Steuern bezahlen müssen. Als der Lehrer merkte, dass unser Sohn sehr musikalisch ist, empfahl er ihn zur staatlichen Musikschule. Auch seine Schwester wird da unterrichtet. Uns kostet das so gut wie nichts. Wo gibt’s denn das sonst auf der Welt? Und sehen Sie sich diese Bürgersteige und Straßen da draußen an: alles ist gepflastert, geordnet, geregelt.«
»Welche Kunden sind eigentlich freundlicher: die Deutschen oder die Türken?«
»Eindeutig: die Deutschen. Sie sind einfach zivilisierter – jedenfalls die Menschen in der Stadt. Wenn ich zum Beispiel einem Jungen oder einem Mädchen Süßigkeiten zustecke und das Kind nimmt das einfach hin, dann sagt jede deutsche Mutter: ›Du musst dich aber dafür bedanken!‹ Wirklich, jede Mutter sagt das. Bei uns in Anatolien, wo die Leute jeden Tag ums Überleben kämpfen, gibt es so etwas nicht. Man kann das niemandem vorwerfen.«
Der Nachbarschaftspolizist vom Revier 17, dessen gütiger Gestus dem amerikanischen Klischee vom fürsorglichen, dem Wohle der rechtschaffenen Bürger verpflichteten Sheriff nahe kommt, erkundigt sich nach dem Wohlbefinden der Familie. Die Afrikanerin, die ihre Kinderkarre mit den Zwillingen vor dem Laden parkt, skizziert, nachdem sie eine Dose »Pizzatomaten« in ihrer Tasche verstaut hat, die katastrophale Lage in ihrer somalischen Heimat.
Mit dem heiteren Überschwang eines von seiner Kunst und seinem Können überzeugten Jongleurs befördert Önder die Zwei-Euro-Münze, mit der die junge Frau bezahlte, in den offenen Rachen der Registrierkasse. »Ich liebe meinen Beruf«, sagt er.
4 »Den Ball eng führen!«
Beritans Zukunft
Dreizehn Fächer umfasst das Zeugnis, das die katholische Grundschule »Sankt Bonifatius« in Eimsbüttel ihren vierten Klassen ausstellt. Bei dem Schüler Beritan Öylü, dem Sohn der Obst- und Gemüsehändler Fetiye und Önder, schlägt neunmal eine »Zwei« und zweimal eine »Eins« zu Buche.
»In den Gruppenarbeitsphasen«, so heißt es in einem Kommentar des Klassenlehrers, »bringt er eigene Ideen ein und trägt seine Vorschläge verständlich und interessant vor.« Und: »Durch gezielte Antworten trägt er zur Lösung eines Problems bei.« In einem Zusatzbogen wird Beritan attestiert, sich »in besonderem Maße an den Regeln der Gemeinschaft zu orientieren«. Die verheißungsvolle Prognose: »Aufgrund der bisher gezeigten Lern- und Leistungsentwicklung und den überfachlichen Kompetenzen, ist Ihr Sohn geeignet, das Gymnasium zu besuchen.«
Aber welches Gymnasium? »Ist doch klar: das katholische«, sagt Fetiye, die Mutter.
Katholische Grundschule, katholisches Gymnasium ... Ich frage Fetiye, warum islamische Eheleute ihr Kind ausgerechnet der Obhut kirchlicher Schulen anvertrauen.
»Weil dort, im Gegensatz zu vielen anderen Schulen, konsequent Werte vermittelt werden – Werte wie die Hilfsbereitschaft zum Beispiel, die ich während meiner Krankheit in christlichen Institutionen erfahren habe. Und außerdem genießt dieses Gymnasium wegen seines hohen Leistungsanspruchs einen hervorragenden Ruf.«
»In Beritans Zeugnis fällt auf, dass er im Fach ›Herkunftssprachlicher Unterricht: türkisch‹ die Höchstnote erzielte. Ihr Sohn ist in der Bundesrepublik geboren, und sein bester Freund ist das, was man einen echten Hamburger Jungen nennt. Warum dann noch die zusätzliche Fixierung auf die türkische Sprache?«
»Wir wollen, dass er in beiden Kulturen zu Hause ist. Wenn das gelingt, ist das doch das Beste, was einem Kind passieren kann. Aber auf gar keinen Fall darf man, wenn man in Deutschland lebt, dessen Sprache und Kultur vernachlässigen.«
»Kennen Sie Familien, die gegen diesen Grundsatz verstoßen?«
»Oh, ja. Und einer der wichtigsten Gründe dafür, dass sie so schlecht Deutsch sprechen, liegt im Fernsehkonsum. Seit man in der Bundesrepublik türkische Sender empfangen kann, hocken viele Familien, wann immer sie können, vor der Mattscheibe und sehen sich türkische Trashserien an. Ich kenne Kinder, die sprechen schon genauso wie so wie Stars dieser Programme.«
Der hervorragende Ruf des Sankt-Ansgar-Gymnasiums löst in Hamburg jedes Jahr einen Ansturm an Bewerbungen aus. Hat der Sohn einer sich zu einem Zweig des Islam bekennenden Familie angesichts einer solchen Konkurrenz überhaupt eine Chance? Mit der persönlichen Vorstellung von Mutter und Kind beginnt am Nachmittag des 25. Januar 2011 das Drama des Werbens und des Wartens.
Dienstag, 25. Januar, abends. Auf der von Flutlicht beschienenen Sportanlage des Eimsbütteler Turnverbandes (ETV) trifft sich die E-Jugend zum Fußballtraining. Ich bin dort mit Fetiye und ihrem Sohn, dem Stürmer Beritan, verabredet.
Da sich die beiden wegen ihrer Präsentation im Gymnasium verspäten, sehe ich mich auf dem Gelände des Hamburger Traditionsvereins erst einmal nach Symptomen multikultureller Einflüsse um. Bereits im Schaukasten am Eingang, wo die Werbung von Sponsoren die Ankündigung der nächsten Spiele umrahmt, entdecke ich welche. Die Firma »Adi shakti fashion« bietet in unmittelbarer Nachbarschaft mit bodenständigen deutschen Handwerksmeistern »Mode für Yoga, Wellness und Freizeit« an. Das asiatisch orientierte Unternehmen »Aurasya« wirbt für »diverse Öle aus aller Welt«.
Die in Eigenarbeit gezimmerte Klubhütte heißt »Zum Wilden Sizilianer«. Francesco, der Wirt, verbringt, wie ich den Gesprächen an der Theke entnehme, fast jede freie Stunde in seinem Schrebergarten am Rande einer Autobahn. Sollte die Stadt ihren Plan wahr machen, das Refugium einer neuen Trasse zu opfern, will er sich mit seinen deutschen Nachbarn zusammentun, um dagegen zu protestieren.
»Den Ball eng führen!« – »Dranbleiben!« – »Nicht von der Strecke abkommen!« Von den elf Jungen, die auf das Kommando ihres Trainers Pattrick Dietz auf dem mit rotweißen Plastikhütchen gespickten Kunstrasen Slalom laufen, stammen vier aus der Türkei. Einer von ihnen ist Beritan, der von einer Profikarriere beim Bundesligaverein HSV träumt wie einst sein Großvater von einem Trecker und seine Eltern vom eigenen Laden. Einen »schnellen Antritt«, »Laufstärke« und »viel Herz« bescheinigt ihm sein Übungsleiter, ein Abiturient, der in der A-Jugend des ETV spielt.
»Ist es schwer für Sie«, frage ich den jungen Mann zwischen zwei Trainingseinheiten, »sich auf die türkische Mentalität einzustellen?«
»Überhaupt nicht. Der Vater meiner Freundin ist Türke. Und auf einer Reise nach Istanbul hat sie mir die türkische Kultur nahe gebracht. Auch mit einer meiner Jugendmannschaften war ich schon in der Türkei. Deutsche und Türken – das ist bei uns eine Einheit.«
»Es gibt wirklich keinerlei Unterschiede?«
»Doch. Bei den türkischen Spielern in meinem Team gibt es gewisse Unterschiede. Ich erkenne sofort, wer von ihnen in einem Haushalt mit einem Macho-Vater aufwächst. Die hauen ganz anders dazwischen als ihre Mitspieler.«
»Und Beritan?«
»Der ist immer höflich und freundlich. Ein ganz lieber Junge ist das!«
Читать дальше