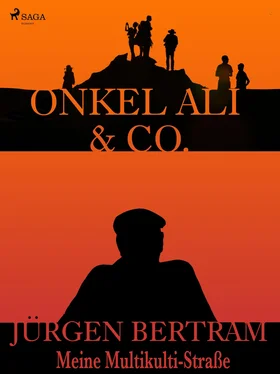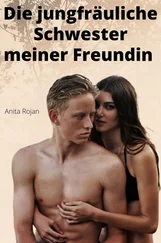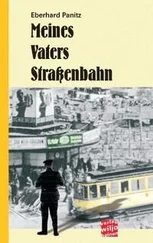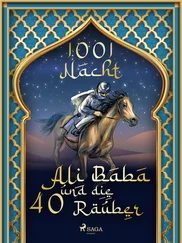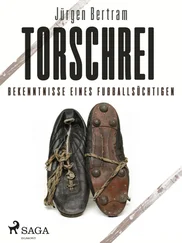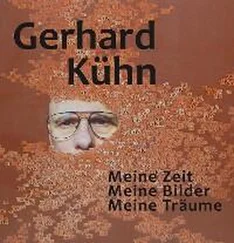»Ihr habt euch als Kinder«, frage ich Arif, »nach euren Vätern gesehnt. Hattet ihr noch eine andere Sehnsucht?«
»Ja. Wir alle wollten mal ein Dolmusch besitzen. So nennt man in der Türkei die Sammeltaxis. Wirklich: Alle wollten das. Und wenn die Schule aus war, dann haben wir Dolmusch fahren gespielt.«
»Und wie ging das?«
»Wir sind auf einen Baum geklettert. Und einer hat sich auf dem dicksten Ast ganz nach vorn gesetzt. Das war der Fahrer. Meistens war ich das. Die Fahrgäste haben sich auf die dünneren Äste verteilt. Bezahlt haben sie mit Blättern. Die großen Blätter waren die Scheine. Die kleinen Blätter waren die Münzen. Na, ja: dann habe ich mit dem Mund ›Brumm, brumm‹ gemacht und schon ging es los: Erzincan ... Istanbul ...«
»... München ... Hamburg ...?«
»Nein, nein. In Istanbul endete unsere Reise. Deutschland war für uns unvorstellbar weit entfernt.«
Doch Mitte 1975 tritt das Unvorstellbare ein. Arifs Mutter folgt ihrem Mann nach Hamburg, und ihren Sohn, der gerade seinen neunten Geburtstag feierte, nimmt sie mit. Die Familie lebt in einer kleinen Wohnung im Arbeiterviertel Wilhelmsburg. Als Arif den gleichaltrigen Sohn der deutschen Nachbarn besucht, mag er nicht glauben, was er sieht. »Das Kinderzimmer war krachend voll mit Spielsachen. Ich fühlte mich wie im Wunderland. Autos, die sich auf Knopfdruck bewegten, Teddybären, die mit dem Kopf wackelten ... das kannte ich doch nicht von unserem Dorf. Mein Mund stand zwei Meter weit auf.«
»Haben Sie den Sohn Ihrer Nachbarn beneidet?«
»Für mich war das eher ein Schock. Beneidet habe ich ihn jedenfalls nicht. Wenn wir in Anatolien gespielt haben, mussten wir all unsere Phantasie aufbieten. Schon über ein paar Steine waren wir froh. Ich glaube, die deutschen Kinder büßen beim Spielen ihre Phantasie ein.«
So fremd bleibt ihm das Leben in der großen Stadt an der Elbe, dass sich Arif nur auf die Straße traut, wenn sein Vater ihn an die Hand nimmt. Auch die Hausfrauen, die den niedlichen Türkenjungen im Kaufhaus liebevoll über den Wuschelkopf streichen und ihm bisweilen ein paar Murmeln oder Süßigkeiten zustecken, können ihm die Ängste nicht nehmen. Also ist er nicht unglücklich, als seine Mutter, die nur ein Touristenvisum besitzt, mit ihm erst einmal zurückkehrt nach Ostanatolien. Was er nicht ahnt: Nun ist er in seinem Dorf ein Fremder.
Die anderen Kinder lachen ihn aus, als Arif seine alte Schulklasse betritt. Der Grund ist sein üppiger Haarwuchs. »Vor der Einschulung wurden die Jungen in meinem Dorf erstmal kahlgeschoren – wegen der Läuse. Haare auf dem Kopf – so etwas kannten meine Mitschüler nicht.«
Aus der Not, als Außenseiter dazustehen, macht Arif am Ende eine Tugend. »Eines Tages bat mich der Lehrer, vor die Klasse zu treten und zu erzählen, was ich in Deutschland erlebt habe. Da ich in Hamburg ja nur ganz selten draußen war, machte ich Figuren aus den Zeichentrickfilmen nach, die ich im Fernsehen gesehen hatte – Donald Duck zum Beispiel.«
Wieder biegen sich die Schüler vor Lachen – aber diesmal, weil sie der Rückkehrer so perfekt unterhält. Arif, den Clown, finden sie toll.
6 »Du musst dem Kunden immer in die Augen sehen!«
Arifs Kampf
Und wie ging es weiter in dem Dorf Sütpinar im Osten Anatoliens? – Ich muss meine Neugier für einige Minuten zügeln, weil eine Schar von Jungen und Mädchen, von denen mindestens die Hälfte aus Familien mit »Migrationshintergrund« stammt, den kleinen Laden an der Gustav-Falke-Straße belagert. Sie kommen von Schulen, die dieses Areal prägen, und decken sich mit dem Proviant für die große Pause ein. »Onkel Ali« nennen sie, eher liebvoll als nivellierend oder gar diskriminierend, den Patron hinter dem Tresen. Damit kennzeichnen sie auch eine ökonomische Zäsur, auf die man allenthalben in der Bundesrepublik stößt: Der Onkel-Ali-Laden hat den Tante-Emma-Laden abgelöst.
Was den Wandel in diesem Geschäft offenbar überdauerte, sind die nachbarschaftliche Geborgenheit und die Überschaubarkeit – Qualitäten, die »Onkel Ali« mit einer Prise augenzwinkernder Generosität anreichert.
»Was kostet die Boulette mit Mayo?«
»Einsachtzig, mein Jung.«
»Mensch, ich hab nur einsfünfzig.«
»Na, gut – einsfünfzig.«
Eine ältere Dame, die der Besitzer mit »Gisela, mein Schatz!« begrüßt, betritt, ihren Rollator voraus, das Geschäft. Die zweite Hüftoperation, klagt sie, habe sie nun schon hinter sich. In vierzehn Tagen, habe der Arzt gesagt, sei alles wieder gut. Nichts sei gut – vor allem bei dem vielen Eis und Schnee in diesem Winter nicht. Bald komme der Frühling mit seinem Grün, tröstet sie der Kundenversteher von der Gustav-Falke-Straße.
Grün – das ist das Stichwort, auf das sich der von immer mehr Schülern frequentierte Onkel-Ali-Laden für einen seligen Moment in eine Musical-Bühne verwandelt. »Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blü-hen«, singt, den Ton jederzeit kontrollierend, die vom Schicksal geplagte Rentnerin. Und dann erzählt sie – zum wievielten Male eigentlich? – die Geschichte von ihrer gescheiterten Ehe mit einem Kripobeamten, einem »Schlipsträger«, der viel zu »etepete« gewesen sei und sie vor allen Leuten korrigiert habe, wenn sie nach dem dritten Glas Wein vom Hochdeutsch in den Slang verfallen sei. Die zwei Jahre mit dem Italiener, die der Scheidung folgten, »ach, war das eine schöne Zeit«. Nun, meint sie, habe ein Galan aus dem Iran ein Auge auf sie geworfen. »Guck ihn dir genau an«, rät Arif.
Die Kundin verlässt das Geschäft mit leeren Händen. Der Sohn des Besitzers, dem vor wenigen Tagen bei uns im Flur eine Kiste mit Mineralwasser entglitt, wird ihr die Ware ins Haus liefern – ein Service, den die Supermärkte in der Nähe ebenso wenig bieten wie den ganz persönlichen Plausch. Und: Arif öffnet seinen Laden bereits um sechs Uhr morgens, also weitaus früher als die in großen Ketten organisierte Konkurrenz. Um 18.30 Uhr ist Feierabend.
Eine andere ältere, aus Polen zugewanderte Frau wendet sich an den Besitzer. Sie komme gerade aus dem Krankenhaus zurück und habe erfahren, dass der Krebs, unter dem ihre Mutter leide, Metastasen streue. »Sie wird nicht mehr lange leben, aber sie hat Gott im Herzen«, sagt sie. »Wann sie stirbt«, besänftigt der Moslem die Katholikin, »das weiß nur der da oben.« Dabei zeigt er, natürlich ungewollt, auf den »Jägermeister«-Hirsch an der Wand.
Nicht in seinem Heimatdorf Sütpinar geht es damals weiter mit Arif, sondern in Hamburg. Dorthin kehrt er schon 1976 mit seiner Mutter zurück, die nun statt eines Touristenvisums eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. An einem Freitag treffen die beiden in der Hansestadt ein. Schon am Montag hockt der Elfjährige, ohne mehr als ein paar Wörter Deutsch zu sprechen, auf seinem Stuhl in der vierten Grundschulklasse.
Wurde er in seinem ostanatolischen Dorf wegen seiner langen Haare ausgelacht, so stößt Arif in Hamburg wegen seines Kauderwelschs auf Heiterkeit. »Und irgendwann habe ich überhaupt nichts mehr gesagt.« Doch er trifft auch auf Verständnis und Hilfsbereitschaft. »Eine Mitschülerin nahm mich irgendwann mit zu sich nach Hause mit und stellte mich ihrer Mutter vor. Und diese Frau hat mir in mühevoller Kleinarbeit die deutsche Sprache nähergebracht. Mit den Begriffen für Obst und Gemüse fingen wir an: ›Das ist ein Apfel, das eine Birne, das eine Mohrrübe, das eine Kartoffel‹. Am schwierigsten war für mich der Satzbau. Es hat lange gedauert, bis ich begriff, dass es heißt: ›Wir gehen morgen in die Moschee‹ und nicht: ›Wir morgen Moschee gehen.‹«
Arif bringt es bis zur achten Klasse – und das bedeutet: Er hat keinen Abschluss. Da er aber schulpflichtig bleibt, verweist man ihn an eine berufsfördernde Gewerbeschule. Im Herzen von Sankt Pauli liegt sie, dem in aller Welt bekannten Rotlichtviertel. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, die sich dort seinerzeit im Zuschneiden von Holz und Metall oder im Anstreichen üben, haben einen ähnlichen Hintergrund wie Arif, für den es von nun an bergauf geht – nicht steil, aber ständig. Es ist eine Karriere der kleinen Schritte.
Читать дальше