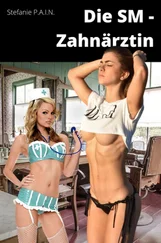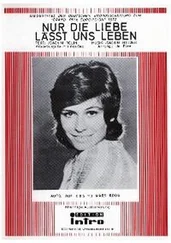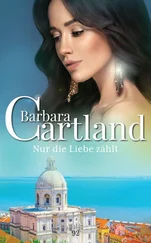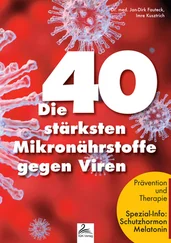Die Universität ist wie eine nicht ausreichend sterilisierte Konservendose«, sagte irgendwann einmal eine Professorin auf einem Weihnachtsfest, oder war es vielleicht ein Sommerfest? »Die Universität befindet sich in einem Zustand von chronischem Botulismus«, fügte sie hinzu. »Alle Zwischenfälle können sich schnell verbreiten und maximal entwickeln. Es bestehen kaum geeignete Bedingungen für Nachsicht und wenig Raum für Vergebung.«
Der Rotwein aus dem Karton hatte sie redselig werden lassen. Ihr Gegenüber nickte, ergriffen von der Wahrheit in ihren Worten. Aber sie waren ja beide ziemlich blau.
Und es kann durchaus etwas Wahres dran sein. Trotzdem würden viele den Kopf schütteln, sich in dieser Beschreibung nicht wiederfinden. Es ist jedoch eine unbestreitbare Tatsache, dass nur äußerst wenige der wissenschaftlichen Mitarbeiter ihren Job an der Universität aufgeben. Man bleibt dort, bis man körperlich und seelisch erstarrt und in Pension geht, ohne sich notwendigerweise jemals weit von dem Gang entfernt zu haben, in dem man sein Arbeitszimmer hatte. Wahrscheinlich ist man ständig unzufrieden. Aber man bleibt trotzdem.
Denn obwohl Universitätsangestellte zunehmend als Überreste einer vergangenen Zeit betrachtet werden, man ihnen mit herablassender Neugier begegnet, haftet einer Professur doch immer noch ein gewisser Status, ein gewisses Prestige an.
Ein anderer Grund, aus dem die Angestellten bleiben, ist, dass das Universitätsleben kaum Anforderungen stellt, wenn man dort erst einmal festen Boden unter den Füßen hat. Das kann anstrengend sein, ja. Aber für viele ist es ein beschütztes, angenehmes Dasein. Und oft haben sie auch keine Alternative. Für andere Arten von Arbeit haben sie sich gründlich disqualifiziert. Wenn man zehn, fünfzehn Jahre damit verbracht hat, alles über die Vokale des Suaheli oder die metrischen Muster in Emily Dickinsons Lyrik zu erforschen, hat man nicht gerade Kompetenzen erworben, nach denen die übrige Gesellschaft gierig schreit.
Von außen gesehen kann das Universitätssystem durchaus liberal wirken. Aber in der Konservendose, unter dem dicht schließenden Deckel, herrscht eine strenge Justitia. Die Angestellten überwachen einander mit Argusaugen. Wenn man in der Kaffeepause nicht über die Universität schimpft, macht man sich verdächtig. Wenn man die Universität öffentlich kritisiert, wird man totgeschwiegen. Wenn man keinen Erfolg hat, wird man verachtet. Aber auch die Erfolgreichen kommen nicht ungeschoren davon: Ist jemand ein guter Pädagoge und zugleich beliebt bei den Studenten, gerät er in Verruf. Vermittelt man zu viel, wird man zu oft in Presse und Fernsehen zitiert, gerät man in Misskredit, denn dann ist man oberflächlich und populistisch. Normalerweise gilt die Regel: Je weniger Leser, desto bessere Forschung. Aber wenn man nur in gewichtigen internationalen Zeitschriften veröffentlicht, wenn man angesehene wissenschaftliche Auszeichnungen erhält, wird man garantiert aus der netten Runde am Mensatisch ausgeschlossen.
Böse Zungen behaupten, die Universitätskultur züchte die Mittelmäßigkeit. Der Mittelmäßige ist der klare Sieger, aber wichtiger als fachliche Mittelmäßigkeit sind soziales Wissen und die Fähigkeit zum Netzwerken.
»Aber wir dürfen die Freuden nicht vergessen«, nuschelte die Professorin auf der Weihnachtsfeier nach zwei weiteren Gläsern des billigen Kartonweins. Und sie hat recht: Es gibt auch aufrichtige Forschungsfreude und fachliche Begeisterung, es gibt einen starken Glauben an das Wissen, ein unerschütterliches Vertrauen in die Wissenschaft. Auf jeden Fall! Das Universitätswesen basiert in hohem Maße auf der glühenden Leidenschaft der Angestellten. Das tut diese Geschichte ebenfalls. Edith Rinkel, Pål Bentzen und Nanna Klev glühen. Und sie sind keine Mittelmäßigkeiten. Niemand würde auf die Idee kommen, Edith Rinkel als Durchschnittsmenschen zu bezeichnen, und auch Pål Bentzen und Nanna Klev sind eindeutig weder durchschnittlich noch mittelmäßig.
Wenn es darum geht, Verbündete zu finden und in sozialen Netzwerken nach oben zu klettern, bestehen jedoch große Unterschiede zwischen Edith Rinkel, Pål Bentzen und Nanna Klev. Alle drei wissen sehr gut, worauf es ankommt. Sie beherrschen die Kunst des Kletterns. Aber mindestens eine von diesen drei Personen wird zu hoch klettern und abstürzen. Und viele werden sagen, sie habe es verdient.
Einige Tage bevor Pål Nanna zum ersten Mal begegnet, ist er in Amsterdam. Es ist ein brütend heißer Tag Ende September, die Straßen sind voller Menschen, die Rad fahren, Eis essen oder beides zusammen. In den Straßencafés drängen sich die Gäste. Die Amsterdamer heben schwere Biergläser zum Mund. Die Sonne lässt das Bier aussehen wie flüssiger Bernstein. Es wird eifrig geplaudert und emsig zugeprostet. Alle sind laut und munter, einige Kinder kreischen und lachen. Eine Mutter ruft ihre Söhne zur Ordnung, gibt ihnen aber nach dem Klaps auf den Hintern Geld für ein weiteres Eis – denn dieser Tag ist so wunderschön, dass das Eisgeld lockerer sitzt als die Strafpredigten.
Plötzlich bellt ein Hund, und von einer benachbarten Veranda antwortet ein anderer. An den Grachten spazieren Paare Arm in Arm, mit leichten Sommerkleidern und dunklen Sonnenbrillen, hinter denen sich verliebte Augen verbergen. Auf dem Damrak, neben dem riesigen Befreiungsdenkmal, lässt jemand einen CD-Player auf höchster Lautstärke laufen, und mindestens ein Dutzend Jugendlicher stürzen sich sofort in einen halsbrecherischen schweißtreibenden Tanz, sie vergessen eventuelle Sorgen und feiern den Sommer mit schwingenden Armen und ruckartigen Kopfbewegungen.
Aber Pål sieht nichts von alledem. Er ist zu einem Kongress hier. Einem linguistischen Kongress unter der Regie der Vrije Universiteit Amsterdam. The Fourth Symposium on Language Changes in the Future . Er sitzt in einem halb vollen Hörsaal, auf einer harten Bank, der schmale Tisch, auf dem seine Papiere liegen, ist am Rücken der Bankreihe vor ihm befestigt. Der Hörsaal hat keine Fenster, Pål sieht den Sommer draußen nicht, aber er weiß sehr wohl, dass er vorhanden ist. Im Saal ist es unerträglich warm, und das Atmen fällt schwer.
Unten am Rednerpult steht ein Mann von Ende dreißig mit schütteren Haaren, das Gesicht dem Publikum zugewandt. Er hat beide Hände um die niedrige Kante geschlossen, die sich auf drei Seiten um das Rednerpult zieht, auf der schrägen Tischplatte liegt das Manuskript, aus dem er vorliest. Seine Stirn und sein Schädel glänzen vor Schweiß. Der Hals des Mannes ist außerdem mit roten Flecken übersät. Ob das an Hitze oder Nervosität liegt, ist schwer zu sagen. Es kann ein Hitzeausschlag sein, es können nervöse Flecken sein. Pål empfindet einen kurzen Moment des Mitleids, wie ihm das oft passiert, wenn er gehemmten Menschen begegnet, vor allem, wenn diese Hemmungen zu Hautreaktionen führen. Aus alter Gewohnheit wirft er einen Blick auf seine eigenen Arme, die natürlich ganz normal aussehen. Sonnengebräunte Unterarme unter den aufgekrempelten Hemdsärmeln, seine Haare sind in diesen Sommermonaten hell geworden. Aus dem Programm, das vor ihm auf dem Tisch liegt, weiß Pål, dass der Redner Ivar Guðmundsson heißt. Etwas an ihm kommt ihm bekannt vor.
Pål gähnt, lässt sich zurücksinken und spürt, wie der Schweiß aus seinen Achselhöhlen strömt, er fühlt sich überraschend kühl und angenehm an. Pål sehnt sich jetzt nach einem eiskalten Bier, das wäre jetzt perfekt – ein beschlagenes Glas Grolsch. »Ist so ein Glas mit kalter Flüssigkeit außen oder innen beschlagen? Sowohl als auch? Nein, jetzt konzentrier dich gefälligst«, ermahnt er sich. »Der Vortrag hat gerade erst begonnen, noch kann ich einsteigen.« Pål schaltet die Hitze aus, verdrängt den Gedanken an kaltes Bier und den flirrenden Sommer draußen, und richtet seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Worte des Vortragenden.
Читать дальше