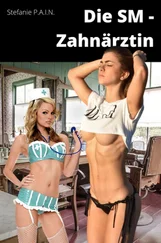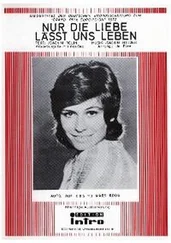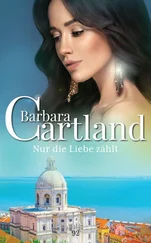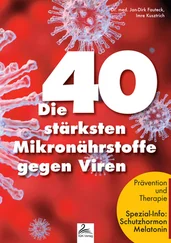Auf der Fensterbank brummte ein Insekt, eine große zottelige Hummel, wütend flog sie immer wieder gegen die Glasscheibe. Es war eine Königin. Nur die Königinnen überleben den Winter, deshalb tragen sie eine große Verantwortung. Die Hummelköniginnen müssen ein Volk gründen, aus dem wieder neue Völker entstehen sollen. Jetzt musste diese Hummel eine Stelle finden, wo sie ein Nest bauen und die Eier legen konnte, die sie den ganzen Winter lang in sich getragen hatte. Die Hummel warf sich verzweifelt gegen das Fenster in Edith Rinkels Büro. Sie wollte einfach das tun, wozu sie erschaffen war, was ihre Instinkte ihr befahlen, aber etwas, dessen Beschaffenheit sie nicht begriff, hinderte sie daran.
Von starkem Mitgefühl ergriffen, öffnete Edith Rinkel das Fenster einen Spaltbreit, danach legte sie beide Hände um die Hummel, um ihre Gefangene dann im Fingerkäfig durch den Fensterspalt zu heben und freizulassen. Die Hummel flog davon, in den Maihimmel, der an diesem Tag auffällig blau war, wie Edith Rinkel bemerkte, von derselben Farbe, die für ihre Fakultät ausgesucht worden war. Ein fakultätsblauer Himmel, dachte Edith Rinkel, und sie bildete sich ein, im selben Moment die gebrummten Danksagungen der Hummel in der Ferne zu hören. Sie lächelte über diese kindlichen Gedanken (Hummeldank! Fakultätsblau!), aber wenigstens war sie jetzt wieder guter Laune, und voller Arbeitseifer und Tatendrang setzte sie sich an ihren Computer und machte da weiter, wo sie beim Erscheinen des grenzdebilen Studenten aufgehört hatte.
An diesem Tag würde es keine Mittagspause in der Mensa geben, sie beschloss, ihr Kapitel fertig zu schreiben, sie würde sich zwei Stücke Knäckebrot aus der Packung nehmen, die sie immer in der Schublade liegen hatte. Für Edith Rinkel bedeutete das kein großes Opfer, sie zog in vieler Hinsicht Knäckebrot ohne Belag und ihre eigene Gesellschaft frischen Brötchen und dem albernen Gefasel der Kollegen vor. Denn das hier ist die Geschichte einer Professorin, die in ihrem eigenen Fach, ihrer eigenen Tüchtigkeit aufgeht. Es ist Edith Rinkels Geschichte. Aber es ist nicht nur ihre Geschichte. Es ist auch Pål Bentzens Geschichte, die Geschichte des Forschers, die Geschichte des rothaarigen Linguisten.
Mit dem Erzählen einer Geschichte anzufangen ist eigentlich unmöglich, oder genauer gesagt: Zu wissen, wann und wo sie beginnt, ist unmöglich, denn das Leben ist ja eine Linie von der Geburt bis zum Tod, eine einzige durchgängige Linie, Sekunde um Sekunde wächst sie weiter, erschafft sich selbst. Ab und zu scheint sie davonzurennen, ab und zu schlendert sie so gelassen, dass das Leben fast stillzustehen scheint. Manchmal steigt sie steil nach oben, wenn sich gute Dinge ereignen, und dann kann man durchaus sagen, dass die Lebensfreude neue Höhen erreicht. Aber manchmal fällt die Linie steil ab, die Lebenslust ist am Boden.
Nicht die Boulevardzeitungen haben diesen Strich erfunden, der das Leben symbolisiert und der nach oben zeigt, wenn angenehme Dinge passieren, und nach unten, wenn man leidet. Edith Rinkel und Pål Bentzen befassen sich mit der Sprachwissenschaft. Sie befassen sich mit Linguistik. Und durch ihren Beruf haben sie beide natürlich das in sprachwissenschaftlichen Kreisen sehr bekannte Werk Metaphors we live by aus den frühen Achtzigerjahren gelesen – dieser Klassiker von Lakoff und Johnson, der aufzeigt, dass wir ununterbrochen Sprachbilder benutzen, dass die Alltagssprache von ihnen wimmelt und dass die Bilder oft universal sind, dass sie in hohem Maße auf physischen Gesetzen und auf Eigenschaften des menschlichen Körpers basieren. Oben ist gut, unten ist schlecht. Diese Metapher ist eine anthropologische Konstante und in allen Sprachen der Welt wiederzufinden.
Norweger schütteln den Kopf, um Nein zu sagen, Bulgaren nicken, um dasselbe zum Ausdruck zu bringen. Die Sprache Rotokas auf Papua-Neuguinea hat nur elf Phoneme, die afrikanische Sprache! kung dagegen besitzt nicht weniger als 141 unterschiedliche Laute. Man schreibt von rechts nach links oder von links nach rechts, in waagerechten oder senkrechten Zeilen. Die alten Römer und auch die nordischen Runenmeister schrieben bisweilen auch in Schlangenmustern, erst von links nach rechts und dann von rechts nach links, wie die Pflugfurchen auf dem Acker. Es gibt so viele Unterschiede, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine der etwa 6000 Sprachen auf der Erde positive Gemütszustände mit dem Adverb hinunter und negative mit dem Adverb hinauf ausdrückt, ist äußerst gering.
Das hätten Edith Rinkel und Pål Bentzen uns beide erzählen können. Edith Rinkel hätte das zweifellos gern getan. Sie hätte eine kurze und überaus scharfsinnige Einführung über Lakoff, Johnson und die kognitive Linguistik gehalten, vermutlich hätte sie auch die Kritik an der Theorie eingebaut, sie hätte es jedenfalls nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, die Gegenargumente auszulassen. Wenn ihr der Verdacht gekommen wäre, dass ihre Zuhörer ihr nicht folgen könnten, hätte sie nach einer Weile kurz genickt, sich umgedreht und uns verlassen. Die Absätze ihrer äußerst eleganten Schuhe wären durch den Gang geklappert. Und wir, ihre Zuhörer, wären stehen geblieben und hätten hinter ihr hergeschaut.
Pål Bentzen wiederum hätte es geliebt , über das Buch von Lakoff und Johnson erzählen zu dürfen, und bestimmt hätte er seine Zuhörer bezaubert. Ja, er hätte uns bezaubert. Denn Pål Bentzen bezaubert seine Mitmenschen oft, vor allem die weiblichen. Er hätte die spektakulärsten Beispiele ausgesucht, die unvergesslichsten Textstellen. Er hätte mit den Händen gefuchtelt, und vermutlich wären ihm die Haare in die Stirn gefallen. Pål Bentzens tiefe und sonore Stimme hat eine große Reichweite, und er hätte schnell und sicher gesprochen. Seine große Nase hätte ein arrogantes Dreieck in die Luft gezeichnet. Aber er hätte rote Wangen gehabt, deren Ursache eine Mischung aus großem Eifer und fast vergessener Schüchternheit war, einer Schüchternheit, die sich nach einem Ereignis in seinen Jugendjahren eingestellt hat, nach dem ereignis. Pål tituliert das, was damals passiert ist, immer in bestimmter Form und in Großbuchstaben, so groß, dass sie auch in der mündlichen Rede deutlich werden – trotz der objektiv gesehen ziemlich unbedeutenden Beschaffenheit des Ereignisses. Und vielleicht ist das Ereignisder passende Anfang für Påls Geschichte?
Wir haben beschlossen, die Geschichte von Edith Rinkel an einem Tag im Mai beginnen zu lassen, an einem warmen Tag mit hohem und eben fakultätsblauem Himmel, einem Tag, an dem Edith Rinkel sich dermaßen über einen ihrer minderbegabten Studenten ärgert, dass sie sich weigert, ihn weiterhin zu betreuen. Das ist zwar ein zufälliger, aber glaubwürdiger Anfang. Wir könnten auch an einer anderen Stelle anfangen. Wir könnten zum Beispiel mit dem Tag beginnen, an dem Edith Rinkel ihre Professur angetreten hat. Oder damals, als sie den rötlichen Schatten einer gefüllten Karaffe voll Saft sah und erkannte, was sie für ein Mensch war. Aber wir haben uns nun einmal für diesen warmen Tag im Mai entschieden.
Aus irgendeinem Grund scheint es schwieriger, für die Geschichte von Pål Bentzen einen Ausgangspunkt zu finden. Beginnt Påls Geschichte vielleicht erst mit seiner Immatrikulation an der Universität Oslo? Er hatte seine Teenagerjahre soeben hinter sich gebracht, hatte drei Monate zuvor an einem nahe gelegenen Gymnasium die Reifeprüfung abgelegt, er freute sich so, dass er glaubte, in der Nacht vor der Immatrikulation keinen Schlaf finden zu können, aber wie immer schlief er gut, so gut, dass er es nur mit Müh und Not verhindern konnte, bei der feierlichen Zeremonie zu spät zu erscheinen. Als er mit seinem Immatrikulationsbescheid in der linken und dem schlaff-feuchten Händedruck des Rektors als taktiler Erinnerung in der rechten Hand dastand, war er dermaßen von Begeisterung erfüllt, dass er sich fast schämte und sich befahl, sich zusammenzureißen, seinem Mund ein weniger breites Lächeln zu verordnen, das Summen zu unterdrücken, das aus ihm hinauszuperlen drohte.
Читать дальше