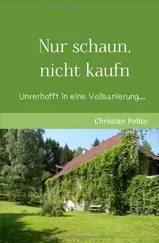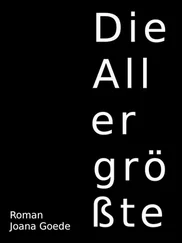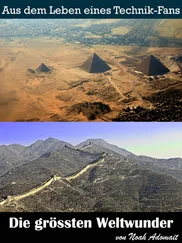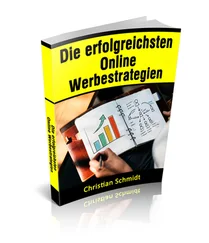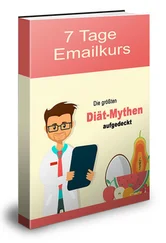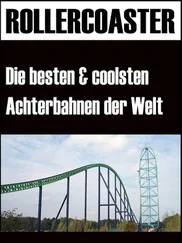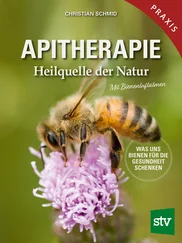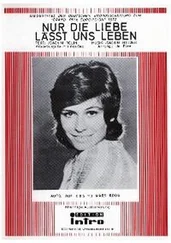Christian Schmid
Nur die allergrössten Kälber wählen ihren Metzger selber
Unsere Tiere in der Sprache
Cosmos Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2021 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: Roland Schärer
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz und Druck: Merkur Druck AG, Langenthal
Einband: Schumacher AG, Schmitten
ISBN 978-3-305-00500-0
eISBN 978-3-305-00501-7
Das Bundesamt für Kultur unterstützt
den Cosmos Verlag mit einem Förderbeitrag
für die Jahre 2021–2024
www.cosmosverlag.ch
Vorwort
Huhn und Hahn
Herkunft und Benennung
Die fürsorgliche Henne
Das dumme Huhn
Mit den Hühnern zu Bett
Der stolze Hahn
Hühnerhaut und Hühnerauge
Hühnerhof und Hühnermist
Ei oder Huhn
Das Huhn als Fleischlieferant
Kuh, Stier und Ochse
Herkunft und Benennung
Dumme Kuh und Hornochse
Die Kuh in Wörtern und Redensarten
Stier und Ochse in Wörtern und Redensarten
Die Schweizer und die Kuh
Stall und Weide
Milch, Rahm, Butter, Käse
Pferd und Esel
Herkunft und Benennung
Ross und andere Freundlichkeiten
Das Pferd in Wörtern und Redensarten
Das Reitpferd
Das Zugpferd
Das Lastpferd
Der Pferdehandel
Der Hausesel
Schwein, Sau und Ferkel
Herkunft und Benennung
Sau und Schwein in derber Sprache
Sau und Schwein in Schimpfwörtern
Sau und Schwein in Redensarten
Das Schwein und sein Fleisch
Der Hund
Herkunft und Benennung
Hunde der Herren, Hunde der Untertanen
Der Hund in derber Sprache
Der Hund in Wörtern und Redensarten
Die Katze
Herkunft und Benennung
Vom Katzenkopf zum Katzelmacher
Die Katze in Redensarten
Seit Jahrtausenden brauchen wir unsere Nutz- und Haustiere. Sie arbeiten für uns, wenn wir auf ihnen reiten, wenn sie für uns Lasten tragen oder ziehen, wenn sie für uns Maschinen antreiben, wenn wir mit ihnen jagen, wenn sie uns mit ihren Kämpfen unterhalten. Sie sind für uns da, wenn sie uns warm geben und wir uns in ihrer Nähe weniger einsam oder sicherer fühlen. Sie liefern uns als lebende Tiere Produkte, die wir essen können: Eier und Milch. Mit ihrem Mist düngen wir unsere Felder. Wir schlachten sie, essen ihr Fleisch, verarbeiten ihre Häute zu Leder, benützen ihre Federn und Haare als Isoliermaterial oder Schmuck und verkochen ihre Knochen zu Leim. Dennoch ist unser Umgang mit ihnen fragwürdig: es fällt uns schwer, ihnen Rechte zuzugestehen. In der modernen industrialisierten Landwirtschaft, die so billig wie möglich produzieren will, behandeln wir viele von ihnen sehr schlecht und gönnen ihnen als hochgezüchtete Massenware nur eine kurze Lebenszeit. Für Nutztiere ist das Leben mit dem Menschen schwierig und oft schrecklich. Kuscheltiere werden hingegen nicht selten so verwöhnt und gehätschelt, dass sie abnorme Verhaltensweisen entwickeln. Einige von ihnen erben Vermögen und werden in Ehren bestattet.
Wir sind unseren Tieren sowohl zu- als auch abgeneigt. Das zeigt sich sehr deutlich in unserer Sprache. Selbstverständlich gibt es zahllose rührselige und sentimentale Pferde-, Hunde- und Katzengeschichten für Kinder und Erwachsene. Aber viel gängiger sind in der Alltagssprache jene sich auf Tiere beziehenden Wörter, Ausdrücke und Redensarten, mit denen wir spotten, schimpfen und beleidigen. Du Hornochse, Rindvieh, Esel, blöde Kuh und fauler Hund sagen wir, ohne auch nur im Ansatz zu überlegen, wen wir da beiziehen, um zu sagen, er oder sie sei dumm, blöd, faul oder störrisch. Wenn wir nicht mehr weiterwissen, können wir dastehen wie der Ochs vorm Berg oder die Kuh vor dem Scheunentor . Wer ausnahmsweise Erfolg hat, kriegt zu hören, dass auch ein blindes Huhn mal ein Korn findet . Wer in soziale Not gerät, kommt auf den Hund . Wer sich rüpelhaft benimmt, lässt die Sau raus .
Der Mensch achtet das Tier weniger als sich selbst, weil er als Homo sapiens die intellektuelle Fähigkeit erworben und Waffen entwickelt hat, jedes Tier, auch das grösste, zu jagen. Einige Tiere macht er sich dienstbar, indem er sie zähmt und züchtet. Der intellektuelle Vorteil, den er dem Tier gegenüber erworben hat, führt dazu, dass er sich als Krone der Schöpfung begreift und daraus das Recht ableitet, die Welt, auch die Tierwelt, zu beherrschen. Dieses Recht wird in der Bibel deutlich sanktioniert. Gott sagt Adam und Eva nach Genesis 1, 28:
«Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.»
Noah gegenüber bestätigt Gott laut Genesis 9, 2–4 die Vormacht des Menschen in der Schöpfung; er bekräftigt damit das Ende des paradiesischen Friedens unter den Geschöpfen:
«Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf die Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt, und auf alle Fische des Meeres; euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch, wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen.»
Die Worte sind klar. Weder Vegetarismus noch Veganismus lassen sich aus der Bibel begründen, obwohl das oft behauptet wird. Wohl lebten einige monastische Gemeinschaften ursprünglich fleischlos, doch die Fleischverbote wurden mit der Zeit gelockert oder ganz aufgehoben. Viele Theologen der frühen Neuzeit behaupteten, die Menschen hätten sich vor der Sintflut ausschliesslich von Pflanzen und Früchten ernährt, so auch der katholische Geistliche Hubertus Lommessen in seiner «Postilla» von 1628: «Ja biss zur zeit dess Sündfluss ist das Fleischessen gar nicht im brauch gewesen.» Nach der Sintflut jedoch habe Gott Noah klargemacht, dass auch das Essen von Fleisch, ausser an Fastentagen und in der Fastenzeit, gottgefällig sei. Das lehren viele Schriften aus der frühen Neuzeit. Hieronymus Bock erklärt in seinem «Kreütterbuch» von 1577 mit Bezug auf die Genesis:
«Erstmals aber / da der allmechtig Gott den Menschen Fleisch zu essen erlaubet / ward kein underschid Fleischs halben fürgeschriben. Dann also sprach Gott zu Noha unnd seinen Sönen / alles was sich regt unnd lebt / das sey ewer Speiss / wie das grün kraut hab ichs euch alles geben.»
Während Bock schreibt, Gott habe dem Menschen erlaubt, Fleisch zu essen, behauptet das «Compendieuse und Nutzbare Hausshaltungs-Lexicon» von 1728, Gott habe das Fleischessen verordnet: «Fleisch, ist diejenige Speise, die Gott uns Menschen von denen essbaren Thieren verordnet, und giebt das Fleisch eine gesunde, starcke und nahrhaffte Speise.» Der Arzt und Philosoph Paracelsus (1493–1541) argumentiert hingegen, dass der Mensch im Schöpfungsakt als Letzter geschaffen worden sei und daraus folge, «das der Mensch die Thier haben muss zu seiner Speiss / zu seiner Notturfft (seinem notwendigen Bedarf) / zu seiner Gesundtheit / etc.» Es gebe kein Tier auf der Welt, behauptet er, das nicht für den Menschen da sei.
Dass wir uns heute ermächtigt fühlen, vielen Tieren nur einen Gebrauchswert zuzugestehen und sie massenhaft in Tierfabriken zu halten, hat auch mit der Einschätzung des Tiers seit der frühen Neuzeit zu tun. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Darüber wurde vom 16. bis ins 18. Jahrhundert heftig diskutiert, sowohl theologisch und wissenschaftlich als auch philosophisch, aber immer so, dass dem Menschen eine Sonderstellung zugestanden wurde. Der französische Philosoph René Descartes (1596–1650) behauptete, nur der Mensch verfüge über Geist. Tiere hatten, so seine Meinung, keine empfindende Seele, er hielt sie für eine Art komplexe Apparate. Andere, wie der Schweizer Arzt und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), behaupteten, das Tier habe eine Seele, aber eine ganz andere als die menschliche. Diese sei denkend, die tierische «ohne alle Vernunfft». Wieder andere behaupteten, sich auf antike Autoren berufend, Pflanzen hätten eine vegetabile, Tiere eine sinnliche und Menschen eine vernünftige Seele. Verstand und Willen kennzeichne den Menschen, behauptet ein Autor 1771, das Tier sei bloss sinnlich und unvernünftig. Wenn der Mensch seinen Verstand nicht einsetzt, handelt er wie ein unvernünftiges oder eben dummes Tier, ein animal irrationale , wie es im Lateinischen seit der Antike heisst. Im 16. Jahrhundert mahnt Martin Luther in einer Tischrede, der Mensch lebe dahin «ärger als ein Vieh». Er schätze Gottes Schöpfung nicht und missbrauche sie. Das sei «gleich als wenn eine Kuhe und unvernünftig Thier die aller schönsten und besten Blumen und Lilien mit Füssen träte».
Читать дальше