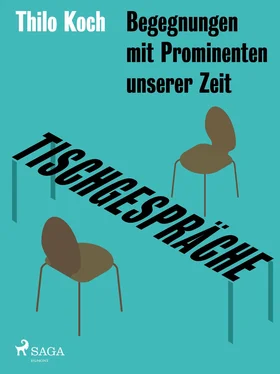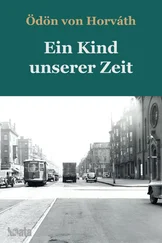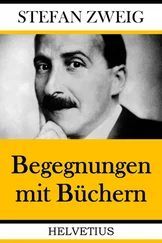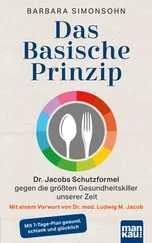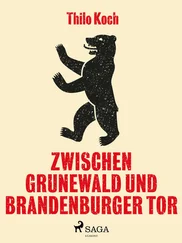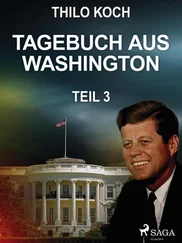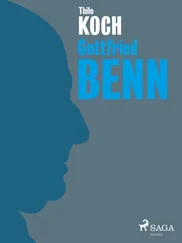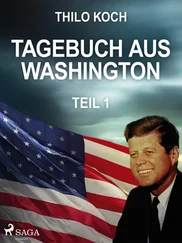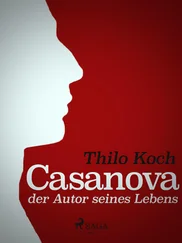»Hat dich swinging London geprägt? England, the british way of life?«
»Mehr als alles andere. Ich bewege mich dort am reibungslosesten, lebendigsten. Meine jüngste Tochter Daphne, 15, ist ein typisches Collegegirl. Meine erste Frau war Engländerin, die zweite ist Amerikanerin.«
»Sehr emanzipiert?«
»Sie ist berufstätig, Historikerin, übersetzt aus dem Russischen.«
»Und ist liberal mit ihrem liberalen Ralf, schätze ich. Und wer hat dich in der Soziologie am meisten beeinflußt? Die Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno?«
»Nein, im Gegenteil: Karl Popper.«
»›Die offene Gesellschaft und ihre Feinde‹ ist ja auch für Helmut Schmidt eine Art Evangelium. Übrigens, du hast dich manchmal etwas reserviert über den Altbundeskanzler geäußert?«
»In Hamburg beim Studium war er unser Vorsitzender, beim SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund), und wir Jungen mochten die altgedienten Offiziere nicht. Er war ein guter Kanzler. Er war der einzige westliche Regierungschef, der etwas von Wirtschaft und Strategie verstand. Aber er zeigte es zu sehr, zu lehrhaft. Seine Arroganz machte ihn unbeliebt.«
»Die SPD ohne ihn. Deine Partei ohne Scheel, jetzt ohne Genscher. Auch ohne Dahrendorf? Werden euch die Grünen nicht ablösen als Zünglein an der Waage im Parteienringelreihen bei Bund und Ländern?«
»Im Bund wird die FDP sich knapp halten. Die Grünen gehen an ihren inneren Widersprüchen kaputt. Und an der Demographie.«
»An der?«
»Wir haben eine schrumpfende Bevölkerungsentwicklung. Es wird immer weniger Junge und immer mehr Alte geben. Das verteilt auch die Farben im Parteienspektrum allmählich um. Ohnehin ist der Trend: neokonservativ.«
»Jeans raus, Krawatte rein?«
»An der Uni noch nicht, aber schau mal in einige Gymnasien, da ist Bügelfalte optimal.«
»Ich mag sehr dein Amerikabuch ›Angewandte Aufklärung‹. Rennen wir Europäer wieder einmal den USA hinterher?«
»Europa wird und wird nicht, jedenfalls nicht so, wie wir es uns dachten. Der Weltgeist, wenn es einen gibt, hält sich heute in den USA auf.«
»Aber du fliegst sicherlich nicht nur deshalb so gern über den Atlantik, um drüben den Weltgeist von Hegel zu grüßen. Du findest dort deine eigene Unruhe, ›aufgehoben‹ – im Hegelschen Sinn.«
»Unruhe ist der natürliche Mittelpunkt des Lebens.«
Sagt’s, lacht noch einmal kurz und trocken und sitzt schon im wartenden Taxi, als ich, ihm freundlich nachblickend, meinen Kaffee gemächlich trinke.
WIEN, WIEN, NUR DU ALLEIN . . .
Vom rotgedeckten Frühstückstisch im Restaurant
des Hotels im Palais Schwarzenberg blicken wir in
den Park, der das Palais Schwarzenberg und das
Schloß Belvedere verbindet, das sich vor 300 Jahren
Prinz Eugen, der edle Ritter, bauen ließ.
»Dort drüber wohne ich«, sagt Gerd Bacher,
»im Gesindehaus des Belvedere.«
Österreichs Würdenträger werden auch heute, im Zeitalter der Demokratie, feudal untergebracht. Die Schlösser, Palais und Herrensitze der Habsburger Monarchie sind ja alle noch da. Wien überstand, anders als Berlin, den Zweiten Weltkrieg ohne Totalzerstörung.
»Fünfundvierzig, das verlief bei uns vergleichsweise gelinde, mit den vier Besatzungmächten ›in einem Jeep‹. Aber das Jahr 1918/19, das war hier ein wesentlich tieferer Einschnitt als in Deutschland. Beispielsweise wurde nach dem Weltkrieg Nummer 1 in Österreich der Adel abgeschafft. Seine Durchlaucht, der Fürst Karl Johannes von und zu Schwarzenberg, in dessen Haus wir hier frühstücken, durfte sich nur noch Herr Schwarzenberg nennen. ›Von Karl dem Großen geadelt, von Karl Renner entadelt‹, hieß es damals.«
»Dennoch«, sage ich »blieb Österreich – anders als wir ›draußen im Reich‹ – konservativ bis in die Knochen. Bis heute? Oder heute wieder? Oder heute erst recht?«
Er schenkt sich bedächtig etwas Kaffee nach, greift zu einem Kipferl: »Schauen Sie, der Kreisky, das war doch nichts weiter als ein Theaterdonner, ein sozialistischer. Was hat der denn seinem beklagenswerten Nachfolger Sinowatz hinterlassen? Einen Trümmerhaufen.«
»Sie waren, Herr Bacher, einmal Berater Helmut Kohls, bevor er Bundeskanzler wurde. Und Sie wollten dazu beitragen, daß er es wurde. Wie beurteilen Sie ihn heute, nachdem er es ist?«
Viele kleine Fältchen um die blauen Augen geben seinem Blick etwas Lustig-listiges. Gerd Bacher, ein Herr von 59 Jahren, trägt ein dezent kariertes Jackett, weinrote Strickkrawatte und Pullunder. Er redet lebhaft und gern, kann aber auch aufs Liebenswürdigste geduldig zuhören. Er sagt:
»Man spricht ihm Brillanz ab. Seine Art zu regieren sei ohne Glanz – ein Kleinbürger. Insofern ist Helmut Kohl vielleicht wirklich a bisserl der Gegentypus zum Kreisky. Aber er ist es eben auch im positiven Sinne. Wo auf der Welt finden Sie heute eine so solide, erfolgreiche Regierungsarbeit wie in Bonn? Nennen Sie mir ein einziges Land. Von Wien aus betrachtet, muß ich es schon erstaunlich finden, daß man diesen deutschen Bundeskanzler – und sein großartiges Team notabene – nicht so schätzt, wie er es verdient. Nur weil er nicht so ›brillant‹ ist wie sein Vorgänger Helmut Schmidt?«
»Nun, er hat vielleicht etwas zu vollmundig von der großen Wende gesprochen. Die blieb aus: für die Arbeitslosen, bei der Rentenfinanzierung. Aber Sie kennen nicht nur Helmut Kohl, den Politiker. Man sagt, er liebe Österreich ganz besonders. Warum, was glauben Sie?«
»Er hat 13 Jahre lang hintereinander stets bei uns seinen Urlaub verbracht. Er mag uns, wir mögen ihn. Vielleicht findet er bei uns eine Lebensart, die leichter ist als die seine, wir nehmen halt auch das echt Tragische nicht so ganz tragisch. Nein, ich bewundere ihn wirklich. Allein wie er mit seinem großen Problem in München fertig geworden ist. Na . . .«
Die Serviererin im weißen Schürzchen möchte uns gern noch etwas Kräftigeres bringen, vielleicht Rührei mit Schinken? Er dankt: »Ich unterhalte mich besonders gern morgens in der Früh, aber es bleibt beim kleinen Caféhaus-déjeuner.«
»Was wurde aus dem Wiener-Caféhaus? Ich gehe in Wien natürlich immer mindestens einmal zum Dehmel.«
»Schon der leckeren Canapés wegen?«
»Ja. Und ein bißchen nostalgisch ins Sacher-Café, wo ich früher stets Friedrich Torberg traf.«
»Er und Hans Weigel – in ihrem Caféhaus hielten sie geradezu Hof, täglich. Dort schrieben sie auch ihre Rezensionen, die dann ganz Wien in zwei Lager spalteten. Das ist vorbei. Wir beide, Herr Koch, trafen uns das letzte Mal ja in Ihrer Heimatstadt, in Berlin.
Berlin und Wien haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel auch dies: den Verlust der Juden. Das haben beide Städte nie verwunden. Dreihunderttausend waren es in Wien, die nach dem ›Anschluß‹ 1938 verschwanden, man hatte Wien ganz zu Recht das zweite Jerusalem genannt.«
»Männer von Weltgeltung wie Sigmund Freud mußten emigrieren. Immerhin, Torberg und Weigel, Hilde Spiel, andere kamen nach 1945 zurück.«
»Das war ungeheuer wichtig, ich war ein junger Mann damals, ich habe zu ihren Füßen gesessen. Aber nach Wien kehrten die paar Überlebenden noch zögernder heim als nach Deutschland. Warum? Weil man sich 1945 und danach hier viel schlimmer als bei Ihnen aus der Verantwortung gestohlen hat. Das mußte einem Wiener Juden doppelt widerwärtig sein. Er hatte ja am eigenen Leibe den Antisemitismus Wiens erfahren, auch vor 1938, vor 1933, noch früher, als Hitler selbst seinen Judenhaß hier in Wien so grauenhaft folgenreich in sich aufsog.«
»Gerd Bacher stammt aus Salzburg, wurde fast so etwas wie ein Wiener Lokalpatriot, aber er bleibt auch hier der kritische Beobachter und Historiker?«
Wieder lächelt er lustig-listig mit seinen Augenfältchen: »Vielleicht auch deswegen, weil es sehr wienerisch ist, Wien zu kritisieren.«
Читать дальше