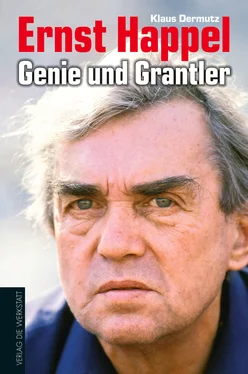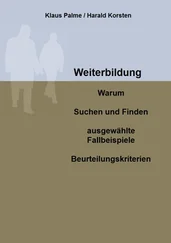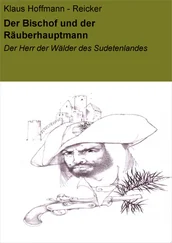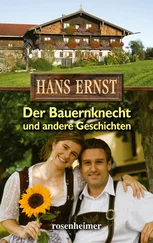1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Der Tod des einstigen Idols ist für Happel der Selbstmord eines in die Enge getriebenen Menschen, dessen Freundin von den Nazis enteignet und verfolgt wurde: »Seine Freundin, eine Jüdin, hatte ein Kaffeehaus. Alles hat man ihr weggenommen – der Hitler war ja schon da. Worauf die beiden beschließen, sich in der Wohnung anzutrinken – und dann das Gas aufzudrehen. Als Hilfe kommt, ist Sindelar schon tot. Seine Freundin atmete noch, aber weil sie Jüdin war, hat man sie sterben lassen. Das weiß ich von sehr authentischen Leuten.« 28
Alfred Polgar schreibt in seinem Nachruf »Abschied von Sindelar«, der zwei Tage nach dem Tod des Fußballspielers auf der dritten Seite der Pariser Tageszeitung (25.1.1939) erscheint: »Er spielte Fußball, wie ein Meister Schach spielt: mit weiter gedanklicher Konzeption, Züge und Gegenzüge vorausberechnend, unter den Varianten stets die aussichtsreichste wählend, ein Fallensteller und Überrumpler ohnegleichen, unerschöpflich im Erfinden von Scheinangriffen, denen, nach der dem Gegner listig abgeluchsten Parade, erst der rechte und dann der unwiderstehliche Angriff folgte. Er hatte sozusagen Geist in den Beinen, es fiel ihnen, im Laufen, eine Menge Überraschendes, Plötzliches ein, und Sindelars Schuss ins Tor traf wie eine glänzende Pointe, von der aus erst der meisterliche Aufbau der Geschichte, deren Krönung sie bildete, recht zu verstehen und zu würdigen war.«
Der aus einer Prager jüdischen Familie stammende Friedrich Torberg veröffentlicht das Gedicht Auf den Tod eines Fußballspielers, das mit folgendem Vers beginnt und schließt: »Er war ein Kind aus Favoriten / und hieß Matthias Sindelar«. Auch Torberg vertritt in seinem Gedicht die Ansicht, dass Sindelar sich umgebracht hat – in einem letzten Protest gegen das NS-Regime: »Es jubelte die Hohe Warte, / der Prater und das Stadion, / wenn er den Gegner lächelnd narrte / und zog ihm flinken Laufs davon, / bis eines Tags ein andrer Gegner / ihm jählings in die Quere trat, / ein fremd und furchtbar überlegner, / vor dem’s nicht Regel gab noch Rat. / Von einem einz’gen, harten Tritte / fand sich der Spieler Sindelar / verstoßen aus des Planes Mitte, / weil das die neue Ordnung war. / (…) Er war gewohnt zu kombinieren, / und kombinierte manchen Tag. / Sein Überblick ließ ihn erspüren, / dass seine Chance im Gashahn lag.« 29
Ungefähr 15.000 Menschen folgen Sindelar am Sonntag, dem 28. Januar, auf seinem letzten Weg. Seine Mutter wird von Max Reiterer und Rudo Wszolek gestützt. Den Begräbniszug führen die Nazis an, auf ihren Kränzen sind Schleifen mit dem Hakenkreuz angebracht. Der SA-Brigardenführer Kozich, der SS-Sturmbannführer Rinner und der HJler Otto Naglic erheben am Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof die rechte Hand zum »Deutschen Gruß«.
Seit Sindelars Tod reißen die Debatten über das Ende dieses begnadeten Fußballers nicht ab. In seiner 2005 erschienenen Studie Massen, Mentalitäten, Männlichkeit. Fußballkulturen in Wien vertritt Matthias Marschik die These, eine Rauchvergiftung sei aufgrund eines schadhaften Ofens die Ursache für Sindelars Tod und der seiner Partnerin gewesen, »aber die Gerüchte über Mord, Selbstmord und Doppelselbstmord sind bis heute nicht verstummt, und unmittelbar nach dem Ereignis setzte die Mythologisierung des fußballerischen ›Wienertums‹ ein. In der Folge wurde jedes Spiel zwischen Wien und dem ›Altreich‹ bis weit in die Kriegsjahre hinein zu einer hitzigen Auseinandersetzung um die fußballerische Vorherrschaft und zu einer Manifestation wienerischen Aufbegehrens. Gerade das Wiener Publikum wurde immer weiter radikalisiert, und es kam ständig zu Raufhändel und antipreußischen Ausschreitungen, die nicht selten in vandalistischen Akten endeten. Eine sportliche Versöhnung zwischen Admira und Schalke sollte im November 1940 im Wiener Stadion zur Deeskalation beitragen, doch nachdem der Schiedsrichter zwei reguläre Admira-Treffer aberkannte, erhob sich der ›Volkszorn‹. Tobende Anhänger verprügelten die Schalker Spieler, zertrümmerten die Fensterscheiben des Mannschaftsbusses, zerstachen die Reifen des Wagens von Gauleiter Schirach und lieferten sich stundenlange Schlägereien mit der Polizei. (…) Dies führte dazu, dass nun auch die im ›Altreich‹ gastierenden Teams verbal und auch tätlich angegriffen wurden (…).« 30
Happels Abneigung
Als ich Happel im Oktober 1991 zum NS-Regime befrage, spricht er in sich gekehrt über diese Zeit: »Wie der Hitler da kommen ist, war ich 13 Jahre, wir haben in einem Zinshaus gewohnt, in der Vorstadt, in dem Haus waren 50 Parteien, von der Monarchie noch her, meine Großmutter ist eine Tschechin gewesen, von den 50 Parteien waren 25 Parteien Tschechen, auf jeder Etage hast du eine Wasserleitung draußen gehabt und vier Klos. Wenn die zwei Großmütter bei der Wasserleitung standen sind, haben sie nicht Deutsch gesprochen, sondern Tschechisch. Und dann kommt die bestimmte Diktatur von Hitler, in einer gewissen Perfektion, die Großmutter hat selber sieben Kinder gehabt, vier Mädchen und drei Buben, und der Älteste war ein Super-Nazi, die ganze Familie hat eine Angst gehabt vor dem Mann, der ist überall einmarschiert, u. a. in der Tschechei, da können wir nicht zufrieden sein. Wie der Krieg begonnen hat, der Überfall, dann hat der Hitler Russland angegriffen, der Nichtangriffspakt, hat man alles gewusst, in Wien war die Einstellung so, du kannst mit dem Regime nicht einverstanden sein, aber du kannst nichts machen. Ich bin Ledergalantrist gewesen, das war mein Beruf, du bist da gekommen in die Lehrwerkstätte, wo zwölf solche Jungens waren, da hast du einen Meister gehabt, und du hast müssen, wenn’st reinkommst, Heil Hitler sagen, du gehst zu deinem Arbeitsplatz und nimmst die Schürze, dreimal davor wieder Heil Hitler, ich war auf das nicht eingestellt, ich bin auch nicht interessiert gewesen an der Hitler-Jugend, aber ich habe gewöhnlich hingehen müssen, weil sonst hätte ich nicht bei Rapid Wien in der Jugendmannschaft spielen können, das war eine Verpflichtung, ich habe kein Interesse gehabt, dass ich dreimal da hingehe und dass ich singe die Lieder. Ich war nicht für das Regime, aber was hast machen wollen, du kannst nichts machen, dann war die Lehrzeit, dann bist du Geselle gewesen, dann bist du gleich im Arbeitsdienst, statt neun Monate war ich drei Monate beim Arbeitsdienst, das war damals schon im Jahr 42/43, dann waren in Russland schon die Rückmärsche durch den strengen Winter im 41er Jahr, der Mann wollte die ganze Welt beherrschen.«
Happel wehrt sich gegen den Drill, der durch das NS-Regime seine Jugend bestimmt. Er will bereits in jungen Jahren ein freier Mensch sein, sich niemandem unterordnen müssen. Dies zeigen auch die Erinnerungen seines Mannschaftskameraden Alfred Körner, der mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder Robert zur gleichen Zeit wie Happel zu Rapid kam. Mit den Körner-Brüdern war Happel in tiefer Freundschaft verbunden, sie waren exzellente Spieler der berühmten Rapid-Mannschaft in den 1940er und 1950er Jahren. Körner II war knapp drei Monate jünger als Happel.
Im von Harry Windisch herausgegebenen Happel-Erinnerungsbuch hat Alfred Körner die schwierige Lage der Nachwuchsspieler von Rapid während der NS-Zeit folgendermaßen dargestellt: »Mit der NS-Politik gab es damals immer wieder Probleme, von denen vor allem unser Freund Happel betroffen war. Als HJ-Bann-507-Jugendspieler mussten wir gelegentlich auch an Heimabenden teilnehmen, wobei der zuständige HJ-Führer in der damals üblichen zackigen Form: ›Ein Lied‹ kommandierte. Happel wollte aber nicht singen und hat so lange getratscht und gemeutert, bis er schließlich rausgeschmissen wurde. Das hatte natürlich Folgen, denn wir Jugendspieler brauchten damals immer wieder einen Stempel von der NS-Partei in unseren Spielerpässen, um an der Meisterschaft teilnehmen zu können. Dem Ernstl wurde der Stempel nach diesem Zwischenfall verweigert, und so musste unser Trainer Nitsch einen Canossagang in das damalige Parteilokal in der Diesterweggasse antreten, um mit Hilfe von Interventionen die Sache wieder auszubügeln. Ein anderes Mal hatten wir wieder Probleme mit den damals für Jugendspieler obligaten HJ-Uniformen. Wir mussten im Zuge der sogenannten Gau-Meisterschaften 1939 mit der Rapid-Jugend gegen eine Stadtauswahl von Graz in Wiener Neustadt antreten. Wir gewannen zwar mit 2:1, verloren aber auf dem grünen – oder vielmehr braunen – Tisch mit 0:3, weil wir im Gegensatz zu den Grazern nicht in den vorschriftsmäßigen HJ-Uniformen erschienen waren.« 31
Читать дальше