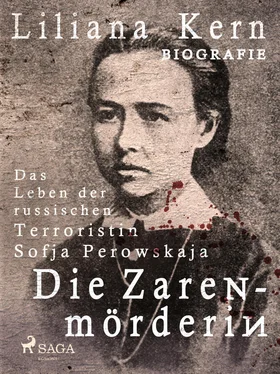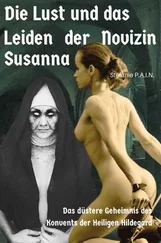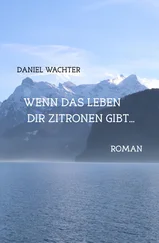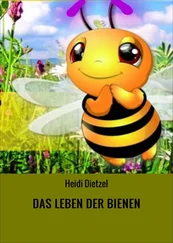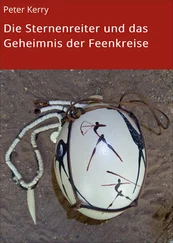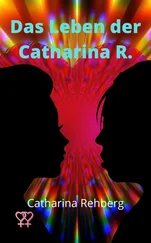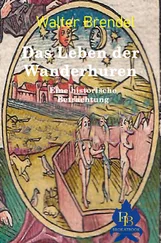Nach der Schule blieben die jungen Frauen weiterhin zusammen und halfen sich gegenseitig bei Hausaufgaben oder besprachen die Bücher, von denen die meisten seitens der Zensur auf den Index gesetzt wurden, weil sie Fragen wie zum Beispiel die des Proletariats, des Klassenkampfes oder der Sozialökonomie behandelten, welche weder dem absolutistischen Staat noch seinem Herrscher genehm waren. Für Sofja stellten die zensierten Titel kein Neuland dar. Dank ihrem Bruder Wassili, dem nach wie vor einzigen und engsten Vertrauten, war sie schon in Berührung mit verbotener Literatur gekommen: »In unserer Kindheit fiel mir die Rolle von Sonjas Spielgefährten zu, und danach, in ihrer Mädchenzeit, bin ich so etwas wie ein Erzieher für meine Schwester geworden, weil ich sie mit der Lektüre versorgte, die ihre Ansichten entscheidend beeinflusste.«
Zu Beginn von Sofjas Weiterbildung an den Alartschinski-Kursen, im Herbst 1869, studierte Wassili bereits am Petersburger Technischen Institut und verkehrte in radikalen Jugendkreisen. Unter deren Einfluss beteiligte er sich an den seit dem Ende des vergangenen Jahres andauernden Studentenunruhen; durch sie sollte die Rückkehr des Zaren zum ehemals liberalen Kurs erzwungen werden. Das Ergreifen der repressiven Maßnahmen durch Alexander II. nach dem Schuss Karakosows bekam die Jugend besonders hart zu spüren. Mit der Ernennung des erzkonservativen Grafen Dmitri Tolstoj zum Bildungsminister kehrte in das russische Schulwesen die Ära des Obskurantismus zurück. Doch die Jugendlichen, da sie schon einmal in den goldenen Apfel der Freiheit gebissen hatten, wollten auf die liberalen Privilegien nicht mehr verzichten. Der Zar war lediglich dazu bereit, einige halbherzige Zugeständnisse zu machen, da die Protestkundgebung aufgrund ihres lokalen Charakters keine ernst zu nehmende Gefahr für ihn darstellte, weswegen sie auch relativ zügig unter Kontrolle gebracht wurde. Die Teilnahme an dem Aufruhr trug Sofjas Bruder eine zweimonatige Studiensperre ein.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Graf seinen zwanzigjährigen Sohn wegen der Kontakte zu den extremen Gruppierungen jemals zur Rede gestellt hätte. Es entsteht im Gegenteil der Eindruck, als würde Perowski auf Wassilis Interesse für die revolutionären Ideen nicht nur mit Verständnis reagieren, sondern vielmehr dieses sogar unterstützen: Von mehreren Besuchsreisen bei dem Bruder Petr in Genf brachte er auf die Bitte des jungen Mannes die Werke der in Russland verbotenen zeitgenössischen Autoren mit, die letztendlich auch in Sofjas Händen landeten. So war sie in die »Tabu«-Themen schon eingeweiht, als sie sich an den Diskussionen ihrer Mitschülerinnen beteiligte.
Aus den inoffiziellen Gesprächsrunden der Kursteilnehmerinnen bildeten sich im Laufe der Zeit mehrere Zirkel heraus. So schlossen sich Sofja und Anna Wilberg der Gruppe an, die um Alexandra Kornilowa, die Tochter des Inhabers der Petersburger Porzellanfabrik »Gebrüder Kornilow«, versammelt war. Das Mädchen organisierte in ihrer Wohnung regelmäßig Sitzungen, welche Sofja sehr ernst nahm und von denen sie nicht eine einzige verpasste, »diejenigen, die nicht pünktlich erschienen, fauchte sie scharf an«. Ein wenig später stieß zu dem Arbeitskreis auch Jelisaweta Kowalskaja aus Charkow, ein zierliches Mädchen mit einer nachdenklichen Miene, über dessen Brust zwei lange, dicke Zöpfe herunterhingen. Die uneheliche Tochter eines Gutsbesitzers und einer Leibeigenen brachte im Alter von sieben Jahren den Vater dazu, der Mutter den Status einer freien Bürgerin zu verleihen. Sie gehörte zu den ganz wenigen Menschen, welche die verschlossene Sofja an sich heranließ, zu welcher sie ihr Leben lang einen engen, innigen Kontakt aufrechterhielt. Die Kowalskaja erinnert sich an ihren ersten Abend bei Alexandra Kornilowa in der Wladimir-Straße: »Ich ging durch die offene Tür und betrat den geräumigen Flur, ausgestattet mit Palmen, teuren Spiegeln und Kleiderständern, die von großem Luxus zeugten. Aus dem benachbarten Raum ertönte ein ohrenbetäubender Lärm, verursacht durch die Stimmen vieler Frauen, die sich einen erbitterten Streit lieferten. Ein Mädchen, klein und von kräftiger Statur, eilte mir entgegen. Die Art und Weise, wie es gekleidet war, verriet es sofort als eine Verfechterin der Frauenrechte: Sie hatte kurz geschnittene Haare und trug einen schwarzen Rock, darüber ein Herrenhemd, das um die Taille von einem Ledergürtel umschlossen war. … Überhaupt ähnelte sie mehr einem Jungen als einem Mädchen. Das war Alexandra, die jüngste der vier Schwestern Kornilow. Sie hieß mich willkommen und führte mich in das mit Wortgefechten erfüllte Zimmer, durch welches dicke Rauchschwaden zogen, sodass man kaum atmen konnte. Etwa zwanzig Frauen fand ich darin vor. Einige von denen unterhielten sich rege, während der Rest, zuhörend, ganz ruhig dasaß. … In der Mitte befand sich eine junge Frau, fast noch ein Kind. Ihr graues, einfaches Kleid mit weißem Kragen, so etwas wie eine Schuluniform, sah nicht besonders schick aus. Es war klar, dass sie dem Kleidungsstil keine Beachtung schenkte, so stand sie in krassem Gegensatz zu den anderen. … Von einer schlanken Blondine stürmisch attackiert, konterte sie zurückhaltend, jedoch mit einer nicht zu brechenden Beharrlichkeit. … Der Blick ihrer grauen Augen war eher ausweichend, doch ihm war eine unbeugsame Sturheit zu entnehmen, genauso wie ihrer Haltung ein gewisses Misstrauen. Wenn sie schwieg, presste sie die schmalen Lippen zusammen, als würde sie sich fürchten, etwas Überflüssiges zu sagen. Ein ernster Ausdruck haftete stets in ihrem gedankenversunkenen Gesicht, alles in allem strahlte die ganze Erscheinung des Mädchens eine klösterliche Askese aus. … Mitternacht war schon längst vorbei, als sich die Gesellschaft auflöste. Die Kornilowa bat mich, noch eine Weile zu bleiben. Nachdem sich die letzten Besucherinnen auf den Weg gemacht hatten, erfuhr ich, dass die junge Frau im grauen Kleid Sofja Perowskaja war.«
Durch ihre Freundschaften geriet Sofja nun in die Gesellschaft der Nihilistinnen, dennoch war sie zunächst offensichtlich nicht bereit, deren antifeminine Einstellung zu übernehmen. Wahrscheinlich fasste sie einerseits immer noch keinen Mut zu einem so radikalen Schritt, denn das Äußere sowohl dieser Frauen als auch ihrer männlichen Gesinnungsgenossen, die sich ebenfalls schwarz kleideten und Jakobinerhüte, lange Haare sowie Bärte trugen, irritierte die Öffentlichkeit so sehr, dass man eine große Portion Begeisterung und nicht weniger Kühnheit brauchte, um sich mit einem solchen Habitus unter Menschen zu trauen.
Andererseits dürfte diese anfängliche Distanzierung ebenfalls auf der Unfähigkeit der blutjungen Sofja beruhen, den Sinn des nihilistischen Strebens nach der absoluten Befreiung des Individuums aus dem Joch der Kirche, Familie oder des Staates zwecks Schaffung eines »neuen Menschen« zu begreifen. Diese kurzlebige Bewegung der 60er und 70er Jahre entstand in der Umbruchsära der bereits erwähnten Reformen Alexanders II., in welcher alle bis dahin geltenden Werte, sei es politischer, kultureller oder religiöser Natur, in Zweifel gezogen wurden. »Nihilist ist ein Mensch, der sich vor keiner Autorität verbeugt, keinem Prinzip blind vertraut, möge man ihm noch so viel Zuversicht schenken«, definierte Iwan Turgenew den Anhänger der jungen Skeptikergeneration und gab ihm zugleich den Namen: Der Dichter leitete den Begriff vom lateinischen »nihil« (»nichts«) ab.
Die Befürworter einer neuen, auf antitraditionellen Grundlagen basierenden Gesellschaft machten die staatlichen Behörden, vor allem die Polizei, auf sich aufmerksam. »Es reichte lediglich eine solche Lappalie, wie kurz geschorene Haare bei Frauen oder ein langer Bart, um einen jungen Menschen zum Staatsfeind zu erklären und ihn ins Gefängnis zu stecken. Daraufhin verbannte man ihn irgendwohin, weit weg, und zwar ›auf unbefristete Dauer‹, wie man es im bürokratischen Jargon formulierte.«
Читать дальше