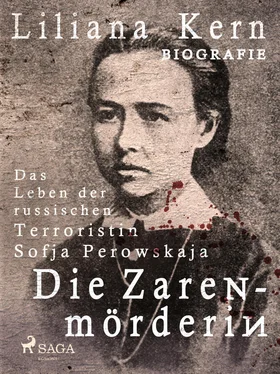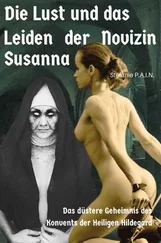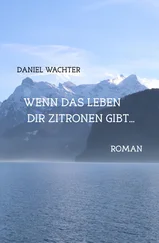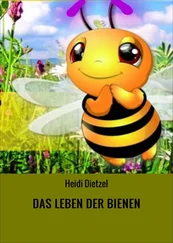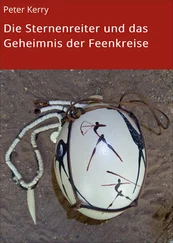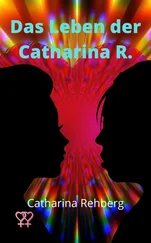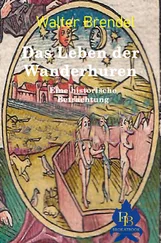›Ich habe die Perowskaja seit einer Weile nicht mehr gesehen. Sie kommt nicht mehr zum Unterricht, und ich bereite mich gerade darauf vor, sie zu besuchen, weil ich dachte, dass sie vielleicht krank ist‹, spielte ich die Unschuld vom Lande.«
Natürlich halfen ihre nihilistischen Freundinnen Sofja, unterzutauchen. Den Unterschlupf fand sie in der Wohnung der Schwestern Karali, ebenfalls zweier Kursteilnehmerinnen. Da die Polizei nach ihr fahndete und sie sich deshalb nicht auf die Straße traute, saß sie tagelang in den vier Wänden eingesperrt. Die zwangsläufige Gefangenschaft hielt Sofja nicht länger aus und verreiste nach Kijew, wo sie bei einem gewissen Doktor Jegor Emme etwa zwei Monate verweilte. Der Arzt war ebenfalls ein untypischer russischer Vater, weil er seine Tochter Anna sogar in Zürich studieren ließ. In der Schweiz knüpfte die junge Frau Verbindung zu den revolutionären Gruppierungen der russischen Studenten, dank diesen dann auch mit den Petersburger Nihilistinnen.
Da von dem Grafen nach wie vor kein Signal des Einlenkens kam, drohte Sofja mit Selbstmord, sollte er sich weiterhin weigern, ihre Forderung zu erfüllen. Sicherlich litt sie sehr darunter, dass die Mutter ihretwegen einem solchen Kummer ausgesetzt war, und das verzweifelte Mädchen griff nach der Suiziddrohung, um diese für beide Seiten unerträgliche Lage endlich zu beenden.
Die Sorge der Eltern wuchs mit jedem neuen Tag, zugleich schwand ihre Hoffnung, die Polizei würde Sofja aufspüren, bevor sie eine Dummheit begehe. Die permanenten Nervenstrapazen hatten verheerende Folgen für die schon angeschlagene Gesundheit des Grafen, sodass er – dem Rat seines Arztes folgend – letztendlich nachgab, indem er den Bewilligungsbescheid verfasste und Nikolaj ins Innenministerium schickte, um das Dokument beglaubigen zu lassen. Über Wassili landete das Papier bei der Kornilowa, über diese letztendlich bei Sofja. Drei Jahre werden die Eltern ihre Tochter nicht mehr sehen, und »in diesem Zeitraum verlor der Vater kein Wort mehr über Sonja«.
3. Kapitel
Leben in der Kommune
Nach einer zähen und nervenzermürbenden Schlacht ertrotzte sich Sofja die Unabhängigkeit von der elterlichen Obhut und nahm Anfang 1871 ihr Schicksal selbst in die Hand, indem sie zusammen mit ihrer mittlerweile engen Vertrauten Alexandra Kornilowa eine Wohngemeinschaft gründete. Im Grunde genommen unterschied sich diese von Kornilowas bisherigem Arbeitskreis lediglich dadurch, dass die Mädchen diesmal mit vier anderen Freundinnen unter einem Dach wohnten, wobei die beiden eigentlich keine Pioniere auf diesem Gebiet waren: Als sie zusammenzogen, schossen russlandweit Hunderte von sowohl Frauen- als auch Männerkommunen wie Pilze aus dem Boden. Unter dem neuen Modell des Zusammenlebens war eine Gruppe von vier bis sechs Kommunarden oder Kommunardinnen zu verstehen, die sich in einer Wohnung mit ein paar Zimmern, Küche, Diele und Bad einmieteten, zu welcher offiziell etwa zwanzig Mitglieder zählten. Die Gruppen benannte man nach den Straßennamen ihrer Wohnsitze, so gingen Sofja und ihre Mitbewohnerinnen als »Kuschelewer Kommune« in die Geschichte ein.
Diese nihilistischen Ersatzformen für Ehe und Familie dienten zugleich als eine Bildungsstätte mit jeweils einem thematischen Schwerpunkt aus dem Bereich entweder der Natur- oder aber der Geisteswissenschaften. Bei den regelmäßig organisierten Lesungen, Referaten und anschließenden Diskussionen hatten alle Wissbegierigen ausnahmslos das Recht, sich an jeder beliebigen Veranstaltung zu beteiligen. Die um die zwei Mädchen versammelten jungen Frauen beschäftigten sich mit Fragen der politischen Ökonomie.
Die strenge Teilung der Arbeitszirkel nach Geschlechtern resultierte aus dem Streben der Frauen nach Emanzipation und ihrer Befürchtung, die patriarchalisch erzogenen, ja zu dominanten Männer könnten sich auf den Entwicklungsprozess ihrer Selbständigkeit hemmend auswirken, sie würden in ihre traditionelle Rolle, die sie auf diesem Weg abzulegen versuchten, erneut zurückfallen. »Eine Frau muss ihrem Mann gehorchen und mit ihm leben in Liebe, Respekt und unbegrenztem Gehorsam und ihm als dem Herrn des Haushaltes alle Annehmlichkeiten entgegenbringen«, liest man in einem Artikel über Frauenrechte zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Kirche stieß in das gleiche Horn: Sie betrachtete Frauen »dem Mann in jeder Hinsicht untergeordnet« und forderte von ihnen »demütiges Dulden und Selbstaufopferung in ihrer wichtigsten Aufgabe: Kinder zu gebären und aufzuziehen.«
Andererseits aber stemmte sich die Mehrzahl dieser Frauen gegen ein Dasein in der männlichen Nähe, weil sie, so wie auch Sofja, voller Wut und Verbitterung, nicht selten auch Verzweiflung, vor der erzieherischen Tyrannei der Väter bereits geflohen waren, um in den Kommunen Zuflucht zu finden. Wie intensiv der aufgestaute Unmut auf den Grafen Sofjas Leben nachträglich prägte, zeigen die Worte der Alexandra Kornilowa: »Sie [Sofja Perowskaja – L. K.] verachtete den Vater und konnte ihm nicht verzeihen, dass er die Mutter so sehr schikanierte. Unzählige Male hörte ich sie über ihn sprechen. Es scheint, dass kein Mensch auf dieser Welt imstande wäre, so feindselige Gefühle in ihrer Seele zu erzeugen.«
Dennoch sind die Umstände, unter denen Sofja ihre Kindheit und Mädchenzeit verbrachte, im Vergleich mit den Erfahrungen anderer junger Frauen sogar als glücklich zu bezeichnen. Zu dieser Gruppe gehörte zum Beispiel Wera Figner, die als Sprössling einer reichen adeligen Familie 1852 in Christoforowka, einem Dorf unweit der Stadt Kasan, geboren wurde: »Wir wurden äußerst streng erzogen; der Vater war heftig, hart und despotisch, die Mutter gut, sanft, aber machtlos. Sie wagte es nie, uns zu liebkosen, geschweige denn, uns je vor dem Vater in Schutz zu nehmen. Meines Vaters Richtschnur in der Erziehung war: eiserne Disziplin und absolute Unterwerfung … Pünktlich zur Minute mußten wir aufstehen und ebenso zur Minute schlafen gehen. Immer dieselbe Kleidung, dieselbe Frisur …, nach jeder Mahlzeit sich bekreuzigen und den Eltern danken, bei Tisch durfte kein Wort gesprochen werden; widerspruchslos mußte alles gegessen werden, gleichgültig, ob es zu viel oder zu wenig war. Wir sollten lernen, nicht wählerisch zu sein. … Nichts durften wir ohne Erlaubnis anrühren, besonders ja nicht Vaters Sachen; wenn das Unglück geschah, dass man etwas zerschlug oder auch nur an den unrichtigen Platz stellte, dann erstreckte sich der väterliche Zorn über das ganze Haus. Und dann setzte die Strafe ein: Man mußte im Winkel stehen, wurde an den Ohren gezogen oder bekam Schläge mit dem Lederriemen, der immer dazu in Vaters Arbeitszimmer hing. Er strafte grausam, unbarmherzig. Wenn die Brüder gezüchtigt wurden, dann litten wir alle mit. Auch nicht die geringste Kleinigkeit blieb ungestraft. Wir durften nichts vor dem Vater verheimlichen, unerbittlich forderte er die strengste Wahrheit von uns, und die Mutter ging mit ihrem Beispiel darin voran. Wenn auch blutenden Herzens, da sie die Folgen kannte, so verheimlichte sie doch nie auch nur das geringste Vergehen vor dem Vater. Und diese Strenge erstreckte sich sogar auf Unvorsichtigkeiten im Spiel. Wenn wir uns irgendwie wehgetan hatten, so kam noch zu dem natürlichen Schmerz die moralische und physische Mißhandlung des Vaters hinzu. Uns Mädchen schlug er nicht mehr, seit er mich einmal als sechsjähriges Kind während einer stürmischen Überfahrt über die Wolga fast zum Krüppel geschlagen hatte. Aber wenn er uns auch seitdem nicht mehr schlug, so fühlten wir uns doch nicht erleichtert, wir fürchteten ihn mehr als das Feuer; sein kalter, durchdringender Blick genügte, um uns das Blut in den Adern gerinnen zu lassen.«
Ihre Ausbildung absolvierte Wera Figner in einem Klosterinternat. Auf Vaters Anordnung und gegen den eigenen Willen nahm sie danach die Arbeit als Grundschullehrerin in Kasan auf. Erst mit der Heirat gelang es der jungen Frau, sich der väterlichen Obhut zu entziehen. Zusammen mit ihrem Ehemann verreiste sie 1872 nach Zürich, wo sie dann das Medizinstudium begann.
Читать дальше