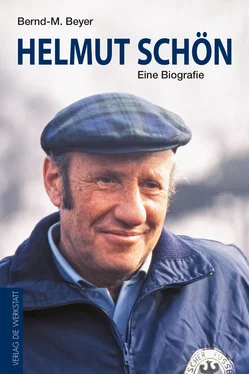Trotz bedenklicher »Luftlage«, wie man damals sagte, waren wir uns der wirklichen Gefahr nicht bewußt.
Meine Frau hatte sich für diesen Abend vorgenommen, einmal gründlich alle Strümpfe zu stopfen. Sie saß auf der Couch, hatte die Strümpfe fein säuberlich neben sich gelegt und hörte beim Stopfen Radio. […]
Meine Frau dachte sich schon, daß es Alarm geben würde und sie in den Luftschutzkeller müßte. Aber das beunruhigte sie nicht besonders. Sie war auf alles vorbereitet. An diesem 13. Februar hatte Annelies die Wintersachen zusammengepackt. Der Winter war vorbei, das spürte man. Da konnte nicht mehr viel Kälte kommen. Die großen Koffer standen fix und fertig auf der Diele. Sie wollte sie am nächsten Tag raus zu Stephans Großeltern bringen und die Frühlings- und Sommersachen von dort abholen.
Dann heulten die Sirenen: Alarm. Sie nahm die Koffer und ging hinunter in den Keller. Es war kurz nach zehn Uhr abends.
Es war ein Luftalarm wie jeder andere, und alle Deutschen waren inzwischen daran gewöhnt, Nacht für Nacht. Diese Gewohnheit der Gefahr gab uns Sicherheit für den Augenblick.
Vierzehn Kilometer von meiner Frau entfernt, draußen in Radebeul, lief ich hinaus ins Freie, weil ich es vor Ungeduld nicht mehr aushielt. Es war viertel nach zehn. Mit ein paar Kollegen setzte ich mich ins Pförtnerhäuschen unserer Firma. Wir starrten nach Süden, wo Dresden lag.
Plötzlich schrie einer von uns auf.
»Da! Da! Die Weihnachtsbäume …«
Unheimlich langsam, unheimlich schön sanken Garben von Leuchtkörpern durch das Dunkel hinunter und erhellten den Himmel über Dresden. So traumhaft und friedlich es aussah, so furchtbar erschien es uns. Wir wußten: Es sind Markierungslichter für die alliierten Bomberflotten.
»Das ist der Tod von Dresden«, sagte einer.
Ein unheimliches, gedämpftes, orgelndes Brummen erfüllte die Nacht: das Motorengeräusch der amerikanischen »Fliegenden Festungen«.
Es wurde immer heller über Dresden. Wir hörten keine Detonationen, nicht das Krachen jener riesigen Bomben, die man »Luftminen« nannte. Der Wind stand gegen Dresden, wir hörten nichts – und das war viel schlimmer. Die Alliierten praktizierten wieder ihre Vernichtungs-Technik, mit der sie schon Hamburg und Berlin weitgehend verheert hatten: Sie warfen Abertausende von Brandbomben, die an sich harmlos aussahen, gut einen halben Meter lange, armdicke Stäbe. Aber diese Brandbomben setzten Dachstühle in Brand. Die Brände vereinigten sich, heizten sich gegenseitig auf, erzeugten durch enorme Hitzegrade einen Feuersturm, der 200 Stundenkilometer und mehr erreichen konnte und ganze Stadtviertel wie Zunder wegbrannte.
Ich versuchte, Annelies telefonisch zu erreichen. War unser Haus getroffen, abgebrannt? Die Leitung war tot. Aber ein Bruder unseres Chefs, Hans Madaus, erreichte uns: »Unser Haus brennt. Kommt, so schnell es geht.«
Wir nahmen einen kleinen Lastwagen und fuhren am Stadtrand entlang. Dresden brannte lichterloh. Ich mußte nicht weinen. Ich war nicht außer mir vor Verzweiflung. Ich fühlte mich nur angespannt zum Zerreißen. Später erfuhr ich, daß die Innenstadt in sieben Kilometern Länge und vier Kilometern Breite ein einziges Inferno war. Aus ihm ist kaum ein Mensch entkommen.
Der Brand der Madaus-Villa war halb so schlimm. Ein Kollege wollte den Laster zurück nach Radebeul fahren und setzte mich unterwegs ab. Ich hatte nur eines im Kopf: »Was ist mit Annelies, steht das Haus noch?«
Hätte ich gewußt, wie es ihr in diesem Augenblick ging, ich hätte Gott auf Knien gedankt. Ein paar Entwarnungssirenen hatten geheult, lang, einförmig, winselnd. Die Leute im Keller Münchner Platz 16, der Apotheker, der Kohlengroßhändler, meine Frau, hatten ihre Koffer genommen und waren wieder hinaus in ihre Wohnungen gegangen.
Annelies erzählte mir später alles: »Bei uns oben waren nur ein paar Scheiben kaputt, in der Diele. Ich habe im Treppenhaus noch Scherben zusammengefegt und dann zwei alten Damen geholfen, ihre Koffer hinaufzutragen. Ich sah, daß es ringsum brannte. Drei Häuser am Münchner Platz standen in Flammen. Aber – das ist wohl das merkwürdigste an menschlichen Reaktionen im Krieg, in einer Katastrophe – ich nahm das apathisch hin. So war das nun mal. Ich habe mich in aller Ruhe ausgezogen, mein Nachthemd angezogen und mich ins Bett gelegt. Keine Vorsichtsmaßnahmen. Nicht: angezogen aufs Bett, weil ja jeden Augenblick wieder Alarm sein konnte … Nein, ich bin sofort eingeschlafen.
Ein Donnern, ein Poltern an der Wohnungstür weckte mich, ich wußte überhaupt nicht, was los war. Im Nachthemd öffnete ich. Draußen stand mein Vater, mit entsetztem Blick, wirrem Haar.
›Annelies! Komm! Die Bomben! Der zweite Angriff! Du musst sofort in den Keller!‹
Zweieinhalb Stunden nach dem ersten Angriff hatte eine zweite Welle von Bombern Dresden angeflogen. Jetzt krachten Sprengbomben in das Flammenmeer. Ich hatte das alles nicht gehört und weiter geschlafen.
Mein Vater war aus Sorge um uns mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, gleich nach der ersten Entwarnung. Dann gab es wieder Alarm, und er erreichte mit Müh’ und Not noch unseren Luftschutzkeller. Er schleppte mich in den Keller und übernahm dort unten gleich das Kommando. Man merkte, daß er im Ersten Weltkrieg Husar gewesen war. Mit seinem bestimmten Ton beruhigte er die Frauen, die laut weinten. Er tröstete die alten Leute, die nur noch jammerten.
Auf einmal knallte es furchtbar. Das Licht im Keller ging aus. Eine Schauspielerin, die in unserem Haus wohnte, begann laut zu beten.
Da brüllte mein Vater: ›Alles niederknien! Mund halten!‹ Keiner sagte mehr ein Wort.
Es war totenstill. Vaters Anweisung hatte Sinn. Durch das Niederknien und Schließen des Mundes wollte er uns so gut wie möglich vor den Folgen des Luftdrucks schützen, falls eine Bombe in nächster Nähe explodierte …«
Zur gleichen Zeit hetzte ich durch die brennende Stadt, in Richtung Münchner Platz. Als die Sirenen wieder aufheulten, war ich gerade am Neustädter Markt, wo das schöne Denkmal von August dem Starken steht. Da fielen schon die ersten Bomben. Ich konnte mich gerade noch in einen öffentlichen Luftschutzraum quetschen. Hier waren ein paar hundert Menschen zusammengepfercht.
Wir hörten, wie der Einschlag der Bomben immer näher kam: Die Erde bebte. Der Putz fiel uns auf die Köpfe. Frauen schrien. Kinder kreischten. Plötzlich brachen Steine aus der Wand des Luftschutzraums. In einer Mauerlücke tauchten, völlig grau bestäubt, mehrere Frauen mit Kindern auf. Sie hatten einen Mauerdurchbruch aufgebrochen, um zu uns zu kommen.
Die Bomben schlugen weiter ein. Neben mir saß eine Frau, die bei jeder Explosion ihre Hand in mein Bein krallte.
Ich bin ganz ehrlich: In diesen Minuten war ich vor Angst fast von Sinnen. Es ist wohl allen so gegangen. Als die Explosionen abnahmen, breitete sich eine grauenhafte Stille im Luftschutzraum aus. Die Menschen stierten vor sich hin ins Nichts.
Ich wollte hier raus. Ich bin losgesaust, über die Augustus-Brücke, Richtung Schloß. Es brannte wie eine Fackel. Feuer, überall Feuer. Brennende Häuser fielen zusammen. Auf den Straßen lagen Frauen, schwarz verkohlt oder ausgetrocknet wie ägyptische Mumien. Sie hatten Kinder im Arm: Aschenbündel. Alle tot, verbrannt, in den wahnwitzigen Hitzegraden des Feuersturms in Sekundenbruchteilen mumifiziert. Skelette lagen da. Daß es sich um Männer handelte, sah man noch an der Gasmaske vor dem Gesicht.
Die Luft war von einem furchtbaren Geheul erfüllt: Der Sog des Feuersturms erzeugte den unbeschreiblichen Ton.
Je näher ich unserem Haus kam, um so mehr würgte mich die Angst: Brennt da auch alles? Dann kam der Münchner Platz. Unser Haus stand.
Es war wie ein Wunder: vor hundert Metern noch Flammenwände und hier alles in Ordnung.
Читать дальше