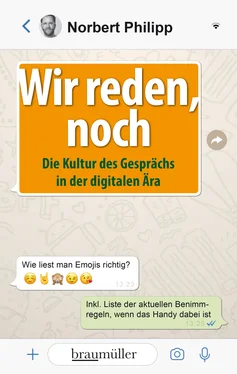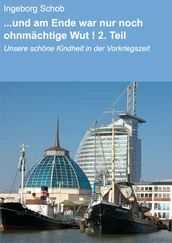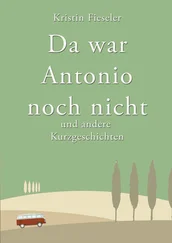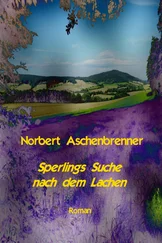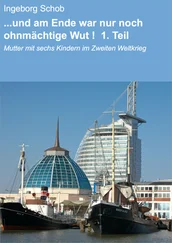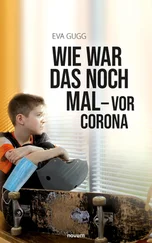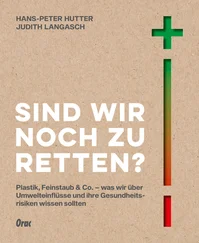Die digitale Ära zerstückelt aber nicht nur die Kommunikation, sondern auch, wie und wie lange man sich anderen Dingen zuwendet. Anderen Menschen. Oder anderen Medien. Kurz genug sollte die Zuwendung jedenfalls sein, um ja nicht tiefer auf den anderen oder den Inhalt einzugehen. Und überhaupt gut zerkleinert in Einzelteile: die Aufmerksamkeit. Das haben durchaus besorgte Jugendforscher schon hie und da angemerkt. Wie etwa auch der Österreicher Bernhard Heinzlmaier, der dem „Mainstream-Menschen der Postmoderne“ schon einmal einen „schizoid-hysterischen Charakter“ zugewiesen hat. 16Klingt jetzt nicht so, als müssten wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Jedenfalls ist die Tiefe nicht unbedingt das, in das die Jugendlichen mit ihrer Aufmerksamkeitsspanne noch tauchen können, seiner Meinung nach. Zumindest ein Zustand bleibt für viele unerreichbar: die „Deep Attention“. Allein weil viele Jugendliche zum Teil die Kapazität dazu gar nicht mehr hätten, sich zu konzentrieren auf eine einzige Interaktion, ein einziges Medium. Eher verzetteln sie sich automatisch in einen Zustand der „Hyper Attention“ – also das ständige, rastlose Springen, von einem Kanal zum anderen. So ähnlich wie damals, nur viel stärker, als plötzlich das Kabelfernsehen ins Wohnzimmer kam und eine neue Verhaltensweise einen Namen brauchte: das Zappen. Aber inzwischen hat man sich ja selbst noch ein paar Kanäle zugeschaltet: Fast 40 Prozent der Jugendlichen wischen über das Smartphone, während sie fernsehen. 17Sich auf ein Signal mal länger einzulassen, das verursacht schon beinahe Langeweile, die Stimulusdichte hochzuhalten ist die Strategie. Und wenn es schon so viel Commitment fordert, einem einzigen Kanal verbunden zu bleiben, was soll denn aus dem Konzept werden, das ehemals bekannt war unter „Verbundenheit“, fragen sich manche. Jedenfalls haben die Jüngeren dieses scheinbar ohnehin schon neu aufgestellt und angelegt: Die Nähe ist jedenfalls nicht mehr das, was sie einmal war. Und die Distanz genauso wenig. Vor allem auf der Ebene der Sprache. Ein durchaus verwirrter Zustand von „Sehr geehrter Du“ macht sich breit unter jenen, die sich zu lange um andere Dinge gekümmert haben als um das, was mit der Digitalisierung der Kommunikation auf uns zurauschte. Man erinnert sich an Zeiten zurück, als sich Nähe und Distanz noch unterschiedlich ausgedrückt haben: im Medium, das man nutzte, im Stil, den man anwandte, oder in Umgangsformen, die man an den Tag legte. Oder in dem, was man sonst noch so vermeldete mit Worten und Körper. Inzwischen signalisieren digitale Medien so viel wie: „Die sanfte Annäherung können wir gern überspringen.“ Mit der ersten WhatsApp-Nachricht schmiedet man eine Beziehung schon allein dadurch, dass man ein bestimmtes Medium benutzt. Mit zwei Jahren Smalltalk im Stiegenhaus wäre man manchmal wahrscheinlich auch nicht weitergekommen.
Lieber Vorname Nachname, das ist inzwischen die gängige E-Mail-Anrede. Da steckt das Angebot des „Du“ schon drin. Der andere muss nur noch darauf einsteigen. Aber „angeboten“ wäre ja noch schön, „aufgedrängt“ trifft es schon eher. Internet macht alle zu Du-Freunden. Aber bitte, komm mir doch nicht zu nahe. Da sprech’ ich dir doch lieber eine Busfahrt lang Sprachnachrichten auf, bevor ich dich anrufe. Denn das wäre mir dann doch zu unmittelbar. Zu direkt. Und anstrengend.
Im Laufe eines digitalen Lebens sammelt man viel mehr Verbindungen mit Menschen, mit denen man früher nicht verbunden gewesen wäre. Dafür werden die kleinen Verbindungen des Alltags weniger. Jene, die man spontan und kurzfristig eingeht, schnell wieder löst. Und wenn sie doch stattfinden, dann serviert einem die Interaktion oft wirklich nicht mehr, als das, was man tatsächlich bestellt hat, den Kaffee und das Kipferl; das Lächeln dazu muss man sich dann oft woanders holen, im Notfall auch digital. Fast scheint es, als wäre Face-to-Face-Kontakt in der Dienstleistungsbranche ohnehin schon zum Plus-Feature geworden. Manchmal muss man es ja schon extra dazubuchen. Wenn man fliegt etwa. Oder wenn man sich ein Hotel wählt, in dem einen noch Menschen begrüßen und Schlüssel übergeben. Denn manche Betriebe haben ja auch schon die Rezeption auf die Gäste ausgelagert. Nämlich auf ihre Handys. Und wo man etwa noch tatsächlich persönlich ein Konto eröffnen kann, dort sind meist auch die Kontoführungskosten höher als bei den Banken, bei denen miteinander Reden gar nicht erst Teil des Geschäftsprinzips ist.
Digital verwirrt, bedroht, gefährdet
Es ist viel passiert. Und ja: Es war schon einiges auf einmal. Da darf man sich schon mal verwirrt, verloren, verunsichert fühlen. Vor allem weil man dachte, dass einem die Welt und alle in ihr plötzlich so viel näher stehen. Warum fühlt man sich manchmal gerade dann einsam, wenn man seinen Freunden beim Leben auf Instagram zuschaut? Oder so im Stich gelassen, wenn man bei Unternehmen ausnahmsweise etwas deponieren will, was keine Bestellung ist, sondern so etwas Unbeliebtes wie etwa eine Beschwerde? Warum ist das Online-Kontaktformular plötzlich die einzige Möglichkeit, sich zu verbinden? Und warum heißen meine Ansprechpartner vor dem @ plötzlich ganz anonym „info“ und „office“ und duzen mich trotzdem zurück? Oder warum nennen sie sich Susi und Angela, obwohl sie keine Menschen sind? Sondern Plauderautomaten. Muss ich zu Chatbots eigentlich höflich sein? Darf man sie anschreien?
Da muss man sich auch erst wieder einmal zurechtfinden im ganzen Chaos der neuen Möglichkeiten. Sicherheitshalber vermutet man ja gern einmal das Schlimmste. So ganz allgemein für die Zukunft, die Jugend und unsere Gehirne. Faul und dumm ist das Mindeste, was das Internet aus uns macht. Das behaupten Psychiater, Neurowissenschaftler, Medienschlagzeilen. Natürlich ist das Hirn der Menschen das erste Opfer der Digitalisierung. Die soziale Kohäsion könnte gleich das Nächste sein. Doch wenn wir uns lieber auf optimistischere Meinungen berufen, dann haben Gehirne und Gehirngemeinschaften trotzdem eine Chance. Vielleicht ist ja alles auch ganz normal. Das durchaus so positiv zu sehen, dazu hätte auf jeden Fall etwas geholfen: ganz einfach in die ganze Sache hineingeboren zu sein. Der britische Science-Fiction-Autor Douglas Adams meinte das zumindest. Noch in der Phase des digitalen Mittelalters, im Jahr 1999. „Everything that is already in the world while you are born is just normal.“ 18Alles, was nach der Geburt erst erfunden wird, daran müsse man sich eben gewöhnen. Und je älter man wird, an umso mehr Dinge muss man sich gewöhnen. Denn umso mehr Dinge sind während der Lebensspanne erfunden worden. Was neu auf die Welt kommt, während man selbst schon 30 Jahre da war, bringt einen erstmal völlig aus dem Konzept, meint Adams. All das sei „against the natural order of things and the beginning of the end of civilization as we know it“. Nachdem man sich zehn Jahre mit dem Neuen auseinandergesetzt hätte, wäre es auch schon wieder „ganz okay“. Mit anderen drastischen Wendungen war es ja nicht anders: Zuerst hat man sich ziemlich gefürchtet, dann akzeptiert, was sich nicht ändern lässt, dann sogar daran gewöhnt und irgendwann will man ohnehin gar nicht mehr ohne leben. Bis zum nächsten dramatischen „Turn“: Plötzlich will keiner dabei gewesen sein, als etwa das Auto jahrzehntelang Gesellschaft und Umwelt gleichermaßen zerfurchte. Doch so gefährlich, wie alle tun, kann es doch nicht sein. Vom sauren Regen spricht doch auch keiner mehr. Aber ganz schön ernst klingt es trotzdem: Eine amerikanische Gehirnforscherin hat zumindest die Digitalisierung als den nächsten „Hot Shit“ der menschlichen Bedrohungen identifiziert. Susan Greenfield setzt sich seit Jahren mit „Screen Technologies“ auseinander. Nur den Klimawandel hält sie für ähnlich bedrohlich wie die Digitalisierung. Sorgen macht sie sich vor allem um die Gehirne und darum, was mit ihnen passiert, wenn sie sich zum größten Teil mit „Screens“ beschäftigen als direkt mit der Welt selbst. 19Für Greenfield steht zumindest fest: Die Gehirne sind jetzt definitiv schon andere als noch vor der Digitalisierung.
Читать дальше