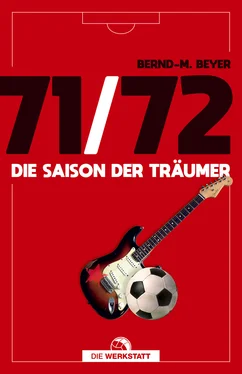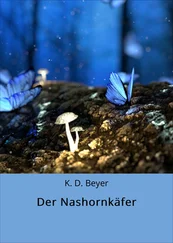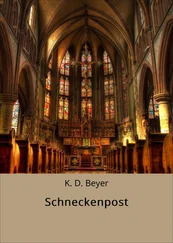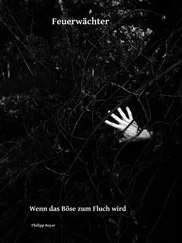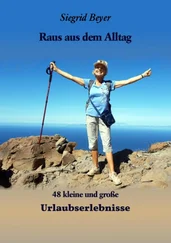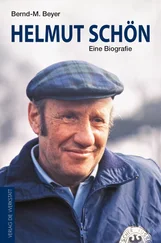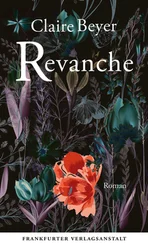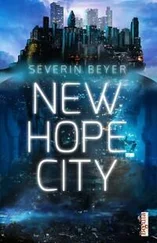Doch auch Kickers Offenbach wird im Schnellverfahren bestraft. Präsident Canellas darf auf Lebenszeit kein Amt im Fußball mehr ausüben, zwei seiner Vorstandsmitglieder auf drei Jahre. Das DFB-Gericht kommt zu dem Schluss, von Canellas sei „ein Gebäude der Vielseitigkeit aufgezogen worden, das es erlauben sollte, nach allen Richtungen hin offen zu bleiben, und zwar je nach Erfolg oder Misserfolg der eigenen Handlungen und dem Ausgang der Bundesligaspiele des letzten Spieltags am 5.6.1971.“ Was ziemlich weltfremd erscheint, denn Canellas hat so viele Personen in seine Aktionen eingeweiht, beispielsweise auch Nationalspieler Wolfgang Overath, dass sie nachträglich kaum unentdeckt geblieben wären.
Die Sanktionen gegen Offenbach werden in der Öffentlichkeit teilweise scharf kritisiert. Der „Kicker“ spricht von einem „Standgericht“ und moniert, das Verhalten der DFB-Verantwortlichen sei nicht hinterfragt worden: Von Canellas informiert, forderten sie von ihm weitere Beweise, statt selbst aktiv zu werden. „Ich brauche nicht die Leiche zur Polizei zu bringen, um einen Mord zu melden“, kommentiert „Kicker“-Redakteur Wolfgang Rothenburg. In der „Süddeutschen Zeitung“ spricht Ernst Müller-Meiningen jr. von „unzureichenden Statuten“, „unzulänglicher Gerichtsbarkeit“, „unbedarften Funktionären“, kurzum von einem „geradezu kriminellen Dilettantismus“. ARD-Sportmoderator Hans-Joachim Rauschenbach hält die Erklärungen des DFB für „so glaubwürdig wie die Behauptung, dass Arsen nützlicher für Kinder sei als Eiscreme“. Und Richard Kirn schimpft: „Für ganz und gar unmöglich halte ich die Verurteilung Horst Canellas’, die ist schon beinahe grober Unfug. Der DFB konnte nie über seinen Schatten springen.“
Chefermittler Hans Kindermann wiederum klagt, dass „man jetzt instinktlos auch über uns herfällt, die die mehr als traurige Pflicht haben, den ganzen Dreck wegzukehren“. Seine Untersuchungen gehen weiter und erfassen in den folgenden Wochen immer mehr Spieler und Vereine. Bald ist die Sache so verästelt, dass die „Bild“ ihren überforderten Lesern über drei Ausgaben ein „Lexikon des schmutzigen Fußballs“ bietet, damit sie den Überblick behalten. In Stuttgart beispielsweise gesteht VfB-Spieler Hans Arnold, er habe für eine 0:1-Niederlage 45.000 Mark von Arminia Bielefeld erhalten und mit zwei weiteren Kollegen geteilt. Seine Geschichte verkauft er gleich exklusiv an das Boulevardblatt: „So wurde ich bestochen“. Kurzzeitig geraten auch die Bayern in Verdacht; MSV-Torhüter Volker Danner behauptet, die Münchner hätten ihm 12.000 Mark für eine Niederlage geboten. Namen aber kann oder mag er nicht nennen.
Mitte August muss Waldemar Slomiany, früher Schalke, heute Bielefeld, als Zeuge vor dem DFB-Gericht aussagen. Es geht um eine Begegnung am 28. Spieltag der Vorsaison. Da hat Schalke 04 ganz überraschend gegen die abstiegsbedrohte Arminia aus Bielefeld mit 0:1 verloren. Schon damals machen dunkle Gerüchte die Runde. Was ihr ehemaliger Mannschaftskollege jetzt aussagt, erfahren die Schalker Spieler noch nicht. Doch sie haben allen Grund, sich Sorgen zu machen.
***
Nicht sonderlich verwunderlich findet die linke Zeitschrift „Konkret“ den ganzen Skandal. „In der Fußball-Bundesliga geht es um Geld. Wer hätte das gedacht?“, lästert Redakteur Jürgen Beier und wundert sich sehr viel mehr über die Empörung im Fußballvolk, „vom Ruhrkumpel bis Beate Uhse“. Sauber gehe es im Kapitalismus schließlich nirgendwo zu, nichts anderes hätten Canellas’ Enthüllungen dem Volk klargemacht: „Was bisher nur für die hohe Politik galt, hatte fortan auch für unseren schönen und kameradschaftsfördernden Fußballsport Gültigkeit: Das ist ein schmutziges Geschäft.“ Der Redakteur sieht einen Ausweg, auf den fünf Jahrzehnte später kommerzkritische Fans noch immer verfallen werden: „Bei solcher Umweltverschmutzung bleibt nur die Flucht aufs Land. Denn dort, in der Kreis- und Bezirksklasse, wird für gezinkte Ergebnisse noch in Naturalien gezahlt. Mit einigen Kästen Bier und saftigen Schinken.“
Dass „Konkret“ die Sexartikel-Händlerin Beate Uhse ins Spiel bringt, ist kein Zufall. Die sexuelle Enttabuisierung, die parallel zur Jugendbewegung der sechziger Jahre begann, hat der Dame gute Geschäfte und Prominenz eingebracht. Auch „Konkret“ will unter Herausgeber Klaus Rainer Röhl – ganz kapitalistisch – von der neuen Freizügigkeit profitieren und füllt die Titelseite sowie bunte Fotostrecken im Heft mit den blanken Busen ziemlich junger Frauen. Dieses nackte Umfeld und Bekenntnisse wie „Orgie frei Haus“, „Ekstase über den Wolken“ oder „Lolita für einen Sommer“ halten bekannte linke Publizisten nicht davon ab, für „Konkret“ zu arbeiten. Anfangs tat dies auch Ulrike Meinhof, einige Jahre Röhls Ehefrau, bevor sie sich mit ihm persönlich wie politisch überworfen hat. Ansonsten schreiben Sebastian Haffner, Günter Wallraff, Franz Xaver Kroetz und Bernt Engelmann ebenso regelmäßig wie die Gerichtsreporterin Peggy Parnass, die als Kind den Holocaust überlebt hat, oder Wibke Bruns, die vor kurzem erst, am 12. Mai 1971 um 22:15 Uhr, im ZDF aufgetreten ist. Worüber sich, wie sie erzählt, ziemlich viele „das Maul zerrissen“ haben. Denn mit ihr verliest an jenem Abend zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Frau die Nachrichten.
Auf die Idee, Pornografie als sexuelle Enttabuisierung zu veredeln, sind auch andere gekommen. Die „St. Pauli Nachrichten“, deren Name nicht auf den Fußballverein, sondern auf Hamburgs „sündige Meile“ zielt, verfügen über ein ähnliches Fotoarchiv wie Röhls „Konkret“. Das Blatt ist eine ziemlich gesprenkelte Blüte der 68er-Bewegung und wurde vom Szene-Fotografen Günter Zint gegründet. Auch hier wollen Autoren wie Stefan Aust und Henryk M. Broder linke Politik mittels freizügiger Erotik an den Mann bringen, wobei der sexuelle Voyeurismus eine deutlich größere Rolle spielt als bei „Konkret“. Vielleicht deshalb beträgt die Auflage zeitweise 800.000 Exemplare.
Die Sammlung von 40.000 Sexfotos in der Redaktion der „St. Pauli Nachrichten“ ist auch das Ziel von Einbrechern, die in der Nacht zum 25. August dort einsteigen. Die 300 Mark in der Kasse lassen sie liegen, die Fotos wühlen sie aus den Schränken. Aber nicht, um sie mitzunehmen, sondern um sie zu vernichten. Per Brandstiftung wird ein Großteil der Bilder zerstört. Hinterher gibt es die telefonische Drohung, man werde die übrigen Fotos auch noch verbrennen. Wer dahinter steckt – ob konservative Sittenwächter oder empörte Feministinnen –, wird nie ermittelt.
Rios Träume
Bundesliga, 3. Spieltag +++ 28. August 1971
Im Hamburger Volksparkstadion beginnt der dritte Spieltag mit einer stolz angekündigten Neuerung: Vor dem Anpfiff sollen zwei Schlagerstars das Publikum „anheizen“. Ob das den wenig bekannten Sternchen Claudia Gordon und Jonny Hill gelungen ist, wird nirgendwo berichtet. Aber immerhin ist es mit 41.000 Zuschauern das weitaus am besten besuchte Spiel dieser Runde.
Zu Gast ist Spitzenreiter FC Schalke 04, der erneut gewinnt, obwohl sein Goalgetter Klaus Fischer verletzt fehlt und Libuda von einer Grippe geplagt wird. Entscheidend ist dieses Mal die starke Defensive. Der Hamburger SV ist ebenfalls gut in die Saison gestartet, vor allem Uwe Seeler, der 35-jährige Fußball-Methusalem, beeindruckt mit drei Toren in den ersten beiden Spielen. Gegen Schalke verpasst er mit einem Pfostenschuss knapp den 1:1-Ausgleich. Es ist Uwes letzte Saison für den HSV.
In Köln sehen währenddessen nur 15.000 einen mühsamen 2:1-Sieg gegen eine schwache Borussia aus Dortmund. Der FC spielt in der Müngersdorfer Radrennbahn, weil nebenan das große Stadion für die Weltmeisterschaft 1974 umgebaut werden soll. Allerdings zeichnet sich schon ab, dass finanzielle Probleme das Projekt verzögern. Das neue Stadion wird am Ende zwar fertiggestellt – aber ein kleines bisschen zu spät, nämlich ein Jahr nach der WM.
Читать дальше