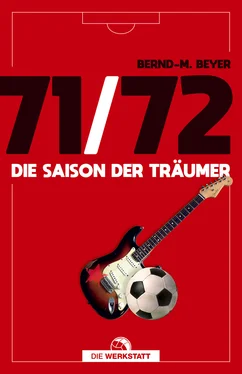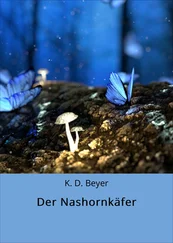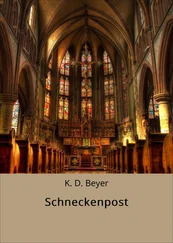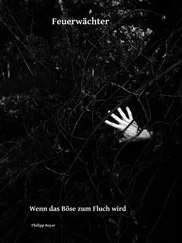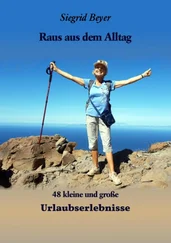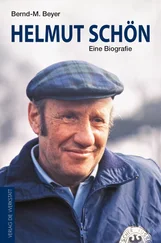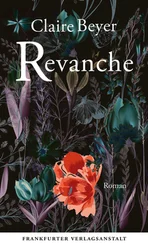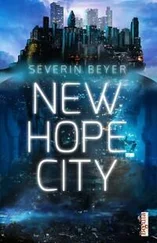Bernd-M. Beyer - 71/72
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernd-M. Beyer - 71/72» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:71/72
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
71/72: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «71/72»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
71/72 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «71/72», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
***
Das Westberlin jener Jahre bebt, hier kulminieren frühzeitig und besonders heftig die Veränderungen, die die westdeutsche Gesellschaft durchschütteln. Hier ist der Protest gegen miefige Autoritäten radikaler und die Reaktion der Staatsgewalt härter. Am 2. Juni 1967 stirbt der Student Benno Ohnesorg durch eine Polizeikugel, nachdem er an einer Demonstration gegen den Schah teilgenommen hat. Rio geht in dieser Nacht über den Kurfürstendamm, hört von erregten Passanten Wortfetzen wie „Krawallbruder“, „selber schuld“ und „Langhaaraffen“.
Genau vier Wochen nach Ohnesorgs Tod feiert im Berliner Theater des Westens die angeblich erste, vor allem aber experimentelle Beat-Oper „Robinson 2000“ ihre Premiere, ein Projekt der Gebrüder Möbius incl. Rio. „Feiern“ ist allerdings das falsche Verb für das tatsächliche Desaster, das sich dort anbahnt. Das Premierenpublikum lacht an den falschen Stellen, und der Applaus am Ende klingt ironisch. Nicht alles geht, auch nicht in Berlin.
Die subkulturelle Szene in der Stadt vergrößert sich rasant: durch Studenten und Akademiker, die den Marxismus oder zumindest die linke Pose entdecken; durch Jugendliche, die keinen Bock auf eine bürgerliche Karriere haben; durch Schüler, die vor autoritären Lehrern oder Eltern fliehen; durch Wehrdienstverweigerer, die in Scharen nach Westberlin strömen, weil die Stadt völkerrechtlich nicht zur Bundesrepublik zählt und daher keine Wehrpflicht kennt. Und die Szene zersplittert: in DDR-orientierte Kommunisten, Maoisten unterschiedlicher Couleur, Trotzkisten, Radikalsozialisten, Pazifisten und Anarchisten; in Hippies, Träumer, Bohemiens, Künstler, Lesben, Schwule und Transvestiten, Spinner, Esoteriker, Faulenzer, Erotomanen, Dealer und Konsumenten von Drogen jeder Art. Allenthalben hört man Bekenntnisse, die vor Kurzem kaum jemand gewagt hätte.
Mitten drin hängt Rio Reiser mit seinen Musikprojekten, der Lehrlingstheatertruppe Rote Steine und vagen Plänen. Schließlich tut er sich mit seinem alten Freund Lanrue und dem Bassisten Kai Sichtermann zusammen, die beide noch bei Hoffmanns Comic Theater aktiv sind, und gründet mit ihnen Ton Steine Scherben. Die Rolling Stones stehen Pate bei der Namensgebung, aber Rio behauptet: auch Heinrich Schliemann. Der soll, als er Troja ausbuddelte, gesagt haben: „Alles, was ich fand, waren Ton, Steine und Scherben.“
Mit marxistischer Theorie und ideologischen Grabenkämpfen kann Rio Reiser nichts anfangen; wie er später schreibt, „be herrschte ich weder das notwendige Soziologen-Deutsch, noch hatte ich Lust, im Berliner Anarcho-Polit-Dialekt zu schreiben“. Eher diffus träumt er von radikalen Freiheiten und „der besten aller möglichen Welten“, will Teil einer Gegenkultur sein gegen Verhältnisse, mit denen er sich nicht identifizieren mag. Deutsch singen die Scherben, um besser verstanden zu werden, denn im Kreuzberg jener Jahre finden sie ihr Publikum nicht gerade im Bildungsbürgertum. Das Manifest der Gruppe, unter dem Titel „Musik ist eine Waffe“ abgedruckt in der Szene-Zeitung „Agit 883“, fordert schlicht und eindeutig „Lieder für das Volk“: „Unsere Musik soll ein Gefühl der Stärke vermitteln. Unser Publikum sind Leute unserer Generation: Lehrlinge, Rocker, Jungarbeiter, ‚Kriminelle‘, Leute in und aus Heimen. Von ihrer Situation handeln unsere Songs. Lieder sind zum Mitsingen da. Ein Lied hat Schlagkraft, wenn es viele Leute singen können. (…) Wir sind in keiner Partei und in keiner Fraktion. Wir unterstützen jede Aktion, die dem Klassenkampf dient. Egal, von welcher Gruppe sie geplant ist.“
Eine solcher Aktionen heißt: Räume für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum in Kreuzberg zu schaffen. Unter den vielen leer stehenden, zum Abriss freigegebenen Häusern wird ein Fabrikgebäude ausgesucht, direkt am Mariannenplatz. Peter-Paul Zahl, Schriftsteller, Druckereibesitzer und einer der Macher von „Agit 883“, organisiert am 3. Juni 1971 in der TU-Mensa eine Fete, auf der auch die Scherben auftreten. Am Ende ruft Rio die Besucher auf, zum Mariannenplatz zu ziehen und das Haus zu besetzen. Die Polizei ist überrumpelt, taucht erst am nächsten Morgen auf und komplimentiert die Besetzer hinaus. Am nächsten Abend sind sie wieder da, in größerer Zahl als zuvor. Der Westberliner Senat hält es nun für klüger zu verhandeln. Die Besetzer dürfen bleiben.
Das Gebäude wird renoviert, für musikalische Untermalung sorgen die Scherben, die dort ihre Songs proben. Mittlerweile sind sie bekannt genug, dass der Süddeutsche Rundfunk ein Fernsehteam für das Jugendmagazin „Jour fixe“ hinschickt. Die TV-Leute filmen in der alten Fabrik just an jenem Augusttag, als die Polizei am Mariannenplatz die fußballspielenden Türken festnehmen will. Nikel, der Manager der Scherben, ist der zufällige Passant, der den Jungs zu Hilfe eilt. Der Kameramann, der die Rangeleien aufnehmen will, gehört zum Fernsehteam. Nikel wandert aufs Polizeirevier, der Film in den Reißwolf. So gibt’s von diesem Ereignis nur die Berichte der Scherben und TV-Aufnahmen lediglich von ihrem Song „Allein machen sie dich ein“.
SEPTEMBER 71
„ Wenn die Schalker so weiterspielen, dann werden sie Deutscher Meister. “
Trainer GUYLA LORANT nach der Niederlage seines 1. FC Köln am 4. Spieltag in der Glückauf-Kampfbahn
„ Mein Tipp ist, dass die Bayern heute gewinnen. “
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident HELMUT KOHL im Programmheft zur Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen FC Bayern am 6. Spieltag. Die Fans am Betzenberg empfangen ihn daraufhin mit einem lauten Pfeifkonzert. Die Bayern gewinnen 2:0.
„ Wenn die Funktionäre schon nicht genau Bescheid wissen, dann sollen ausgerechnet wir Fußballer uns in den Paragraphen auskennen. “
Skandalsünder LOTHAR ULSASS über die umstrittene Frage, ob Spieler von dritten Vereinen Siegprämien kassieren dürfen
„ Der DFB sollte zugeben, dass seine Rechtsorgane überfordert sind. “
DR. JOSEF AUGSTEIN, Rechtsanwalt von Horst-Gregorio Canellas
„Mohammed war ein Prophet“
Bundesliga, 4. Spieltag +++ 31. August/1. Sept. 1971
„Tausend Feuer in der Nacht / haben uns das große Glück gebracht. / Tausend Freunde, die zusammenstehn / dann wird der FC Schalke niemals untergehn.“ So heißt es in dem Schalker Vereinslied, das Jahre später für Kontroversen sorgen wird, weil es darin auch die Zeile gibt: „Mohammed war ein Prophet / der vom Fußballspielen nichts versteht.“ Doch an diesem 1. September wird es in der völlig ausverkauften Glückauf-Kampfbahn unbefangen und inbrünstig gesungen. Und vor allem laut.
Im „größten Siegestaumel seit vielen Jahren“ („SZ“) schreien sich 38.000 Zuschauer die Kehle aus dem Leib, denn Unfassbares geschieht vor ihren Augen: Klaus Scheer, Ersatzstürmer für den noch immer verletzten Klaus Fischer, schlägt in der ersten Halbzeit gegen den 1. FC Köln gleich viermal zu: in der 2., 6., 33. und 42. Minute. Und das, obwohl ihm mit Wolfgang Weber ein starker und erfahrener Verteidiger gegenübersteht. Nach der Halbzeit trifft er sogar noch ein fünftes Mal, 6:2 lautet der Endstand. „Super! Sagenhaft!“, schlagzeilt „Bild“. Die Kölner versuchen sich mit Trainer Gyula Lorant gerade an der Raumdeckung, ein Novum, das gegen Schalke überhaupt nicht funktioniert und anschließend von nicht wenigen Experten für erledigt erklärt wird. Das sei nichts „für Spieler in unseren Breitengraden“, schimpft Wolfgang Overath, denn die „brauchen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben“. Der hitzköpfige Mannschaftskapitän ist im Mittelfeld das Herz der Kölner, zugleich ein gestandener Nationalspieler und wie sein Kollege Weber ein Vizeweltmeister.
Inzwischen haben die Medien statt des Zweikampfs Bayern/Gladbach einen Dreikampf um die Meisterschaft ausgerufen. Zumal beide Favoriten an diesem Spieltag nur ein Unentschieden holen: die Bayern ein 1:1 in Oberhausen, das wie erwähnt einige RWO-Fans übergriffig werden lässt. Und die Fohlen ein elendes 0:0 zu Hause gegen Stuttgart. Nach der seinerzeit gültigen Zwei-Punkte-Regel glänzt Schalke also mit 8:0 Punkten weiter an der Tabellenspitze, und Libuda, so bescheinigt es ihm die „WAZ“, „wirbelte wie in seinen besten Tagen“. Stan selbst sagt: „Ich habe mich noch nie besser gefühlt.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «71/72»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «71/72» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «71/72» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.