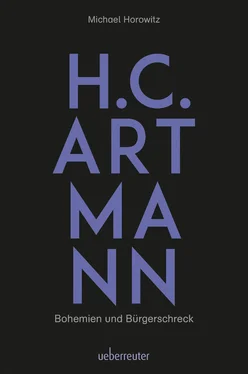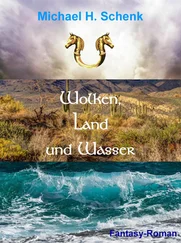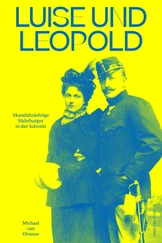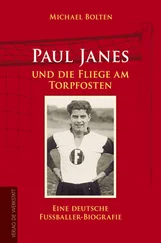Und auch die Pawlatschen, wo früher das Ringelspiel, der Watschenmann und das Kasperltheater gestanden sind, sollten wir unbedingt suchen. Oder das kleine Tschocherl und die Greißlerei hinter der Kirche. Und wir sollten schauen, ob vom Chinesenviertel in der Kuefsteingasse noch irgendetwas zu erkennen ist, ob auf der Steinhoferwiese, einem „wahren Paradies der Beinbrüche, verstauchten Kreuze und ausgekegelten Handgelenke“, noch immer so viel los ist.
Und er wollte mir bei unserer Exkursion das Café Smejkal zeigen, wo man das Bummerl um zehn Groschen ausgespielt hat. Und das 1905 als Zeltkino gegründete „Breitenseer Lichtspieltheater“, in dem er zu Beginn der 1930er-Jahre einen der letzten Stummfilme gesehen hat: „Eine schamlose Frau“ mit Greta Garbo. Und, nach dem Einbau einer Tonanlage, die großen Revue- und Operettenfilme der Ufa wie „Die Drei von der Tankstelle“ mit dem Schlager „Ein Freund, ein guter Freund“.
Hauptdarstellerin des schwungvollen Films, der von der politischen Ohnmacht jener Zeit ablenken sollte, war Lilian Harvey. Der leidenschaftliche Kinogeher Artmann erinnerte sich, dass man damals in den „Illustrierten Blättern“ lesen konnte, dass die aus den Londoner Slums stammende Schauspielerin „ihre in Armut lebenden Angehörigen von der Tür ihrer palastartigen Villa vertreiben ließ, wo sie jeden Tag in deutschem Sekt badete und ihre Fingernägel mit geschmolzenen Perlen überziehen ließ“.
Einmal wartete H. C. am frühen Nachmittag schon unten vor der Haustüre auf mich, Ecke Josefstädter Straße/Schönborngasse. Elegant, im erbsengrünen Corduroy-Twill-Trenchcoat im Raglanschnitt. Der unvermeidbare Tschik – trotz ewiger Bronchitis – zwischen den Fingern. „Soll ich vielleicht mit 79 noch zum Rauchen aufhören?“ Nach der knappen, herzlichen Begrüßung fuhr er mit dem Aufzug wieder in die Wohnung hinauf.
Er war schon zu schwach für unseren Ausflug in seine Kindheit, nach Breitensee. Drei Jahre zuvor rutschte er in der Gardasee-Villa von André Heller am spiegelglatten Parkettboden aus und brach sich das Becken. Seit damals schmerzt jeder Schritt.
Müde von einem Leben aus Euphorie und Einsamkeit, Tatendrang und Traurigkeit hat er sich ein halbes Jahr vor seinem 80. Geburtstag verabschiedet. In „Grammatik der Rosen“ nimmt er 20 Jahre davor das Ende vorweg: „ich lege ein wenig ermüdet mein binokel auf die holzbraune fläche meines fensterbrettes und sage auch als freund adieu, wer weiß, ob ihr mich verstehen könnt, aber es wäre schön, ihr tätet es … adieu!“
REISEN IM WINDSCHATTEN DER POESIE
Späte Ehrungen und ein aschenleichter Tod
Anfang Dezember des Jahres 2000 war in Wien von Adventstimmung noch nichts zu spüren. Die blonde Wetterfee erklärte im Fernsehen, dass Gumpoldskirchen sensationell 19 Grad gemeldet hat und bei uns nördlich des Alpenhauptkamms auf der „Quecksilber-Säule“ momentan um fünf Grad mehr als in Casablanca, ja, und sogar um zwölf Grad mehr als in Damaskus gemessen wurden.
H.C. Artmann litt seit Wochen unter dieser „teuflischen Witterung, diesem furchtbaren Föhn, der drückt so, mein Kreislauf ist im Eimer …“. Schon immer habe ihm der Föhn zu schaffen gemacht und Schmerzen im Knie und im Rücken verursacht. Seit Tagen hat er seine Wohnung nicht mehr verlassen. Der „freund der fröhlichkeit“, der Freund der Frauen, einer, „dem es die Poetik zwar angetan hat, mehr aber noch ein fescher Hintern“, der liebenswerte Strawanzer – in dessen Leben es immer wieder Räusche und Raufereien gegeben hat.
Ein Mann, der früher mit Grandezza als „Artmann Quirin Kuhlmann“, „Metro Goldwyn Artmann“ oder „Artmann of Arabia“ auftrat. Seine Identität und Herkunft verschleierte er gerne spielerisch, sein autobiografisches Verwirrspiel ist auch Teil seines Werkes. H. C. hat viele verschiedene Existenzen und Gesichter, Bärte und Brillen – mit Fenstergläsern.
Er wollte nicht nur ein Leben leben, er pendelte ständig zwischen Dichtung und Wahrheit, nannte sich selbst einen „Schwindler aus Überschwang“. Das fiktive Waldviertler Bauernnest St. Achatz am Walde – die Heimat des „Lyrikers Casimir Achatzhäußer“ – wurde statt der realen Wiener Vorstadt, dem nicht allzu spektakulären 14. Hieb , als Geburtsort angegeben. Dort, wo nur vier Klassen Volks- und vier Klassen Hauptschule reichten, um einer der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts zu werden.
Am liebsten präsentierte sich der Bonvivant aus Breitensee als direkter Nachfahre des Grafen Dracula, als Frankenstein, Sindbad oder Detektiv Tom Parker, als „H. C. artmann, den man auch john adderley bancroft alias lord lister alias david blennerhasset alias martimer grizzleymodld de vere &c. &c.“ nennen kann.
Ein Mensch, der sich und sein Leben nie zu ernst nahm. Einer, der „a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden“ war. Ein Schriftsteller, der die Sprache liebte – ein, wie er selbst sagte, „Kuppler und Zuhälter von Worten, der das Bett bietet“. Ein Einzelgänger, der zwischen Splendid Isolation und ausschweifendem, barockem Spiel pendelte. Er lebte in einer Mischung „aus hemmungsloser Euphorie und ganz stiller Traurigkeit“. Angetrieben von zügelloser Neugier und grenzenloser Fantasie ließ er die Realität oft hinter sich.
Ein rastlos Reisender, der „auf einem großen grünen Walfisch nach der Sandwich-Insel reiten will“. Im Windschatten der Poesie sieht er sich als „Husar mit Schnauzbart“, „surrealer Grenzgänger“, „vazierender Vorstadtpoet“, „chinesischer Hofdichter“ oder „empfindsamer Lauscher an Nachtigallenschnäbeln“.
Doch seit Monaten ist er körperlich geschwächt und zu müde für die Welt draußen. Diese „ganzen Wehwehchen“ seien ihm peinlich, er möchte „stolz abtreten. Mein Tod soll aschenleicht sein. Ich möchte, wenn’s soweit ist, meine Asche verstreuen lassen … auf dem Land. In Irland oder im Waldviertel“, stellte er schon drei Jahre vor seinem Tod fest.
Für Elfriede Jelinek war Artmann „unersetzlich, der auch immer dann seine Würde bewahrte, wenn er wegen seiner Mundartdichtungen oder Steuerangelegenheiten ‚angepinkelt‘ wurde.“ Für den Germanisten Wendelin Schmidt-Dengler „geht eine Epoche der österreichischen Literatur zu Ende“. Zeitungen, Magazine und Fernsehsender nehmen Abschied. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ist zu lesen: „Oft schon ist der Tod des großen Pan ausgerufen worden. Jetzt ist er wirklich gestorben, neunundsiebzigjährig, am späten Montagabend in Wien.“ Und der Lyriker Raoul Schrott formulierte knapp: „Der König ist tot!“
Jahrzehnte vor seinem Tod forderte H. C. Artmann:
Waun i amoi a bangl reis
Zu deidsch: de bodschn schdrek –
I hoff es dauad no a wäu
Bis zu den leztn schrek –
Waun i daun aoesdan schdeam soit
So bit ich eich nua r ans:
Jo nu aka r eangrob aum zenträu!
I schdee ned auf so danzz …
Die Angst vor dem Ende, vor dem Tod, ist aber immer da. Der „älteste traum von der angst, die man nicht haben will, die aber dennoch durch eine hintertür in den mund steigt, sich darinnen breit macht … die angst, die man vor dem tod oder vor dem erbrechen reichlich genossenen alkohols hat.“ Genau eine Woche nach seinem Tod, am 11. Dezember, hätte H. C. Artmann während eines Mittagessens im Stammlokal der letzten Jahre, der „Frommen Helene“, gleich gegenüber seiner Wohnung, die letzte große Ehrung, das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, erhalten sollen.
Im Tagebuch „das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken. eintragungen eines bizarren liebhabers“, einem Diarium mit Erinnerungen, Reflexionen und Überlegungen, die von einer „schillernden, unverwechselbaren Sprachhaut überzogen sind“, beschreibt sich der junge H. C. selbst. Er will beweisen, dass man Poesie auch leben kann. Es ist eine Gratwanderung zwischen Literatur, Ehrlichkeit und Fantasien.
Читать дальше