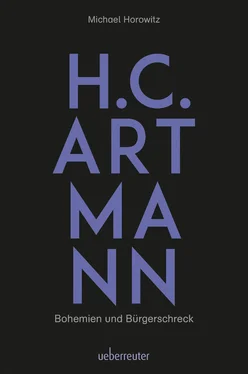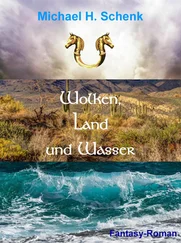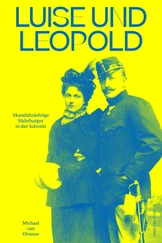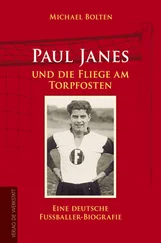… aber mit der wäre er einverstanden, nehme ich an …
Ich glaube, dass ihm meine Interpretation entsprochen hat – zwar nicht hundertprozentig, doch bin ich mir sicher, dass er sich in seinen Intentionen von mir verstanden erlebt hat.
Er ist vor 20 Jahren gestorben, wie hat sich der Stellenwert seines Werkes aus heutiger Sicht verschoben, verändert?
Literatur hat momentan einen geringeren Stellenwert, Werte verändern sich immer. Die Welt von heute ist durchfunktionalisierter denn je. Seine Anschauung war: Ich bin Geist und habe einen Körper.
Er war ein Verwandlungskünstler, der ein Leben lang versuchte, seine Biografie zu verschleiern – hat er sich hinter den Masken und Synonymen von der Außenwelt abschirmen wollen?
Nein. Er hat zeigen wollen, welche Masken wir tragen – sobald wir in Gesellschaft öffentlich werden. Das hat er vorgezeigt. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, er wäre immer in Maske gewesen und sich nie gezeigt hat. Im Gegenteil, ich sage, er hat es gewagt, seine Fehlerhaftigkeit zu zeigen. Er hat kein Bild des Perfekten vorgespielt. Wann ist etwas Maskerade?
Wie würde er heute leben?
Still, über das Alter verändert. Und wäre wahrscheinlich betrübt, was heutzutage vermeintlich Freude macht und das Lebendige zu ersticken droht.
Wie würde er seinen 100. Geburtstag feiern?
Wie immer. Man sitzt, spricht und trinkt. Er wäre froh und traurig zugleich, weil er das Leben sehr schätzte, auch wenn er immer wieder betont hat, wie schwer es ist, zu altern. Über seine Krankheit hat er wenig gesprochen, seine Gebrechlichkeit war für ihn kein Thema. Würdevoll elegant hat er sie angenommen.
Was sind deine schönsten Erinnerungen an ihn?
Kann und will ich nicht sagen. Das Schöne liegt ja im Alltag. Meine schönste Erinnerung an ihn? Er fehlt, und nicht nur mir.
Oft war er schlaflos, hatte immer wieder Albträume von Krieg, Flucht und Überleben … Wie sehr hat das seine Arbeit beeinflusst?
Ja, er hat sehr wenig darüber gesprochen. Er hat die Menschen mit seiner Melancholie äußerst wenig belastet. Es ist in der Literatur auch nicht psychologisch bearbeitet worden, sondern eher archetypisch im kollektiven Unbewussten. Für ihn war das Wichtigste – und sein einziges explizit geschriebenes politisches Manifest: „Nie wieder Krieg!“ Er wäre entsetzt, wie viele Kriege es heute immer noch gibt. Krieg ist das Unzivilisierteste überhaupt. „Warum lesen die Menschen nicht mehr, sondern erschießen andere?“
Er hat einmal gesagt, er habe pro Zeile eine Zigarette geraucht … immerhin ist er 79 Jahre alt geworden. War es leicht für ihn, sich vom Leben zu verabschieden?
Das weiß ich nicht, das sind immer Prozesse. Ich habe seinen nahenden Tod verdrängt und wollte ihn nicht wahrhaben, ich glaube, er hat sein Ende erspürt, aber ich weiß nicht, wie schwer er das Leben verlassen hat. Das ist seine Erlebniswelt, die kann man mit niemandem teilen. Ich war allein mit ihm, als er in die andere Dimension getreten ist. Es war tiefernst und es entstand eine andere Form der Schönheit. Das Ende kann auch eine Form der Schönheit entwickeln. Wie Adolf Muschg einmal erklärt hat: „Das Großartige in der Literatur ist, wenn man zum Beispiel Dostojewski liest, dass selbst in der schlimmsten Thematik eine Schönheit darin liegt, dies zu lesen.“
VIRTUOSER SCHRIFTSTELLER UND FANTASIEVOLLER SPRACHSPIELER
ohne ende seine stolze feuerkunst möge verzaubern
Friederike Mayröcker
H. C. Artmann. Die Sprache ist für den „empfindsamen Lauscher an Nachtigallenschnäbeln“ eine erogene Zone. Wörter seien eine „magnetische masse, die gegenseitig nach regeln anziehend wirkt; sie sind gleichsam ‚sexuell‘, sie zeugen miteinander, sie treiben unzucht miteinander“.
Über den Dialekt bringt der Dichter die Menschen zur Poesie. Der Bonvivant und Bürgerschreck aus Breitensee ist ein liebenswerter Rebell. Ein virtuoser Sprachspieler. Ein literarischer Globetrotter. Ein Mensch mit der Neugier eines Kindes. Angetrieben von zügellosem Wissensdrang und grenzenloser Fantasie lässt er die Realität oft hinter sich.
Im Sommer 1921 kommt Hans Carl im 14. Hieb zur Welt. Seine Mutter Marie kocht wunderbar. Vor allem das „einzig original spezial-erdäpfelgulasch der familie artmann“. Danach türmt sich ein „matterhorn aus häferln und tellern auf dem kuchltisch pres-to-omo-sil-glänzend“.
Der später als H. C. Artmann gefeierte schillernde Schriftsteller wächst in einem winzigen Kabinett mit Fenster auf die Gasse auf. Zwischen Breitenseer Bassena, tristem Alltag und der Poesie der Wiener Vorstadt. Sein Vater ist Schuster. Er stellt sogar Schischuhe her, wie der Sohn stolz meint, dennoch hätte er ihn gerne als Seemann erlebt. Voller Sehnsucht beschreibt Artmann später die Abenteuer in fiktiven, weit entfernten Kontinenten.
Volksschule. Hauptschule B-Zug. Bereits als Vierzehnjähriger beginnt er mit außergewöhnlichem Sprachgefühl wie besessen zu lesen, erlernt durch Selbststudium viele Sprachen. Nach der Schule arbeitet Hans Carl als Lehrling in einer „Chinasilber-Erzeugung“ in Wien-Neubau. Der Chef, der Herr Freisinger, ist nie da, der Lehrbub kann den ganzen Tag lesen. Nur jeden Abend muss er die Post und die Buchhaltung ins Café Tuchlauben bringen, dort tarockiert der Herr des Silbers.
Zweiter Weltkrieg. Oberschenkel-Durchschuss an der Ostfront. 52-prozentige Invalidität. Neun Monate ist Artmann im Lazarett, danach zweieinhalb Jahre in einer Strafkolonie. In Sibirien, Finnland, zum Schluss in Frankreich. Seine permanenten Fluchtversuche werden vereitelt. Schließlich gelingt die Desertation. Er lernt im Krieg mit der Gefahr zu leben. Noch viele Jahre danach hilft das 10er-Valium nicht mehr. Er träumt immer das Gleiche. Von Krieg, Flucht und Überleben.
Am 14. April 1945 verfasst der 24-Jährige sein erstes Gedicht, eine Liebesballade „nach chinesischem und japanischem Vorbild“: „ Unter Blütenbäumen “ , geschrieben in Hollabrunn. Der 24-Jährige widmet es der Tochter eines Müllers, einer Unschuld vom Lande . Jahrzehnte nach dem ersten literarischen Versuch schwärmt der Literaturkritiker Jörg Drews von der Sinnlichkeit seiner Sprache: „Artmanns Dichtung ruft höchste Lust am Text hervor: Die Erotik überträgt sich gewissermaßen.“
Nach 1945 verdient Artmann in Wien während der Besatzungszeit als Postbote ein paar Schilling pro Woche. Abends schreibt er auf einer Maschine, die ihm seine Mutter gekauft hat, Gedichte. Und schickt sie an Radio Wien. Drei davon werden 1947 gesendet. Das Funkhaus der RAVAG liegt in der russischen Zone. Man will mit Schulfunk- und Wissenschaftssendungen vor allem Bildung vermitteln. Ein Auszug aus dem Programm: „Ein Bild fliegt durch den Äther – das Wunder des radioelektrischen Fernsehens“, „Wie das Radium nach Wien zurückkam“, „Mit Atomkraft zum Mond“, „Schildkrötenfang im Atlantik“ oder „Leo Slezak, der Künstler und Lebenskünstler“.
Das autodidaktische Sprachstudium des Kriegsheimkehrers reicht aus, um als Dolmetscher bei der amerikanischen Militärpolizei zu arbeiten. Später übersetzt er aus dem Englischen Nonsens-Verse von Edward Lear und den viktorianischen Kinderroman „Junge Gäste“ des neunjährigen Mädchens Daisy Ashford, aus dem Irischen religiöse Dichtungen der Kelten, aus dem Schwedischen die „Lappländische Reise“ des Naturforschers Carl von Linné. Er überträgt Quevedos „Lebensgeschichte des Buscón“ des frühen 17. Jahrhunderts aus dem Spanischen und das Testament seines französischen Idols François Villon ins Wienerische – von Artmanns Freund Helmut Qualtinger später zu Jazzbegleitung auf einer Schallplatte konserviert.
Читать дальше