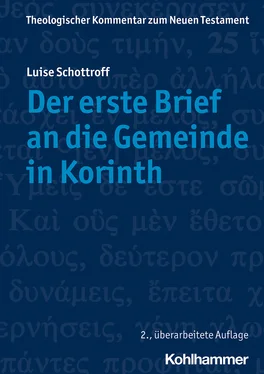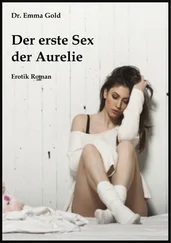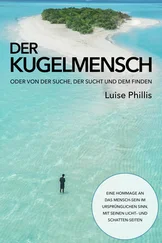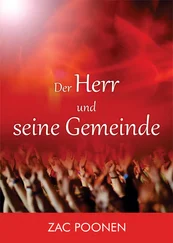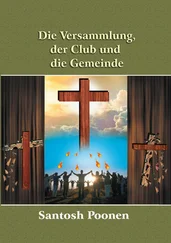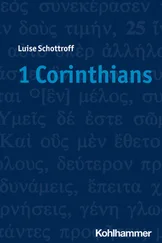Die ausführliche theologische Würdigung der Gemeinde in der Adresse des Briefes schließt Paulus ab, indem er diese Gemeinde in die weitere Gemeinschaft aller, die den Namen unseres kyrios Jesus Christus rufen, einbezieht.
Die Wendung ist durchaus wörtlich zu nehmen: Die Glaubenden rufen öffentlich: „Jesus ist unser Befreier“ / k yrios Jesus (s. 12,3). Der Name, der gerufen wird, ist der Name „Jesus“. Jesus ist ein alltäglicher Name für jüdische Männer (Joschua, Jeschua) . Im frühen Christentum erhält dieser alltägliche Name als Eigenname dieses Messias, der von Rom gekreuzigt und von Gott erweckt wurde, theologische Bedeutung. 25Jesus erhält diesen Namen von Gott, damit in diesem Namen sich die Knie der „himmlischen, irdischen und unterirdischen“ Mächte beugen sollen (Phil 2,10). Mit diesen Mächten sind Kräfte bezeichnet, die die Erde und die Menschenwelt knechten (s. 3,22; 15,24; weitere Erklärung s. zu 15,24). Der Name Jesusverkörpert die von Gott bewirkte Befreiung, denn Jesu Schicksal war bestimmt von der Erniedrigung. Gott setzte seinem Tod und seiner Erniedrigung ein Ende. Er wurde von Gott erhöht. Eine weitere Theologie des Namens Jesus findet sich in Mt 1,21.23. Wenn die Menschen den Namen Jesu anrufen, stellen sie sich in die Gemeinschaft mit dem von Gott aus der Gewalt und dem Tod befreiten jüdischen Mann. So wird er für sie zum kyrios / Herrn, zum Befreier.
Das Wort kyrios ist ebenfalls ein Wort aus dem gesellschaftlichen Alltag zur Zeit des römischen Reiches. Es bezeichnet gängige Herrschafts- und Hierarchieverhältnisse: über Sklavinnen und Sklaven, Abhängige (vom pater familias ) innerhalb der Familie, des oikos / Haushalts, und politische Herrschaftsverhältnisse. Der Kaiser in Rom ist kyrios / dominus der Völker im Imperium Romanum. Wenn in diesem Kontext Menschen Jesus für sich zum alleinigen (s. 8,6) kyrios erklären, werden zum mindesten alle anderen Herrschaftsverhältnisse, in denen jede Frau und jeder Mann leben, relativiert und in Frage gestellt. So verändert der Gebrauch dieses Wortes die Beziehungen, in denen die Einzelnen leben. In den christlichen Handschriften der LXX und in neutestamentlichen Schriftzitaten wird das Wort kyrios als Platzhalterwort für den Gottesnamen verwendet. 26Deshalb ist diskutiert worden, ob die kyrios -Bezeichnung Jesus auf eine Stufe mit dem Gott Israels stellt. Diese Schlussfolgerung blendet den Alltagsbezug des Wortes aus. Sie ist zudem auf dem Hintergrund des jüdischen Monotheismus problematisch. Eher ist anzunehmen, dass das Wort kyrios durch seinen Alltagsbezug für Herrschaftsbeziehungen für Jesus gebraucht werden kann, ohne dass eine Gleichbenennung mit dem Ersatzwort für das Tetragramm empfunden wird. Es erhält seinen Sinn durch den Gegensatz zu den alltäglichen Herrschaftsverhältnissen.
1,3 1,3 Gnade und Friede– beide Wörter haben bei Paulus einen vollen theologischen Klang, wobei er mit diesem Gruß auch an Briefsitten und den jüdischen Friedensgruß anknüpft. 27Die Zuwendung Gottes (Gnade / charis ) wird bei den Beschenkten in ihrem Handeln wirksam. 28Der Friede, der von Gott kommt, steht in Kontrast zur Friedenspropaganda für den römischen Frieden, der pax romana . Der Friede der pax romana wird durch militärische und nichtmilitärische (Rechtswesen, Verwaltung) Gewaltausübung bei den unterworfenen Völkern erreicht. Kaiser Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.) spricht in seinem Testament davon, dass unter seiner Herrschaft „im ganzen Herrschaftsbereich des römischen Volkes, zu Wasser und zu Lande ein durch Siege gefestigter Friede“ 29sein Ziel war, das er immer wieder auch erreichte. Der Friede Gottes hat nach der biblischen Tradition eine ganz andere Qualität: Er bedeutet umfassendes Wohlergehen in Gemeinschaft und Glück für Menschen, für ganze Städte, für ein Volk, den schalom ; dieser Friede orientiert sich also am guten Leben der Menschen, nicht an den Interessen politischer Herrschaft. Durch den Messias Jesus hat Gott sich den Menschen zugewendet und den Frieden auch für die Leute in Korinth zugänglich gemacht.
In 1,4–9 berichtet Paulus über seine Dankgebete, in denen er Gott für den Reichtum der Gemeinde in Korinth dankt – in einem langen Schachtelsatz (von 1,4–8): Der Reichtum besteht in Charismen / von Gott geschenkten Fähigkeiten oder Gaben. Das Wort charisma taucht in 1,7 auf; er nennt (1,5) als solche geschenkten Fähigkeiten: Redefähigkeit (logos) und Erkenntnis (gnosis). In 12,4–11 wird er detaillierter auf sie eingehen. Die Geistkraft Gottes bewirkt diese Fähigkeiten. Der Abschnitt würdigt die Gemeinde positiv ohne Einschränkung, obwohl Paulus in den Kapiteln 12–14 auch Kritik an der Handhabung der göttlichen Gaben äußert. Er kritisiert dort Versuche, mit ihrer Hilfe Hierarchien zu bilden. Es gibt Überlegungen, ob 1,4–9 das Ziel haben, die Adressatinnen und Adressaten zu einer wohlwollenden Aufnahme des Briefes zu veranlassen. 30Doch der Abschnitt ist eher darauf konzentriert, die Grundlagen der Gemeinde und damit des neuen Lebens aller Beteiligten zu nennen: die Zuwendung Gottes (1,4.9), die Gemeinschaft mit dem Messias (1,4.9.6) und die Erwartung eines gerechten Gerichtes Gottes für die ganze Welt (1,8).
1,4 1,4Die Zuwendung (charis) Gotteswird in der Gemeinschaft des Messias erfahren und in den von der Geistkraft bewirkten Fähigkeiten. Die Gemeinde besteht mehrheitlich aus Menschen, die mit den Händen arbeiten (s. zu 1,26). Sie dürften fast alle Analphabetinnen und Analphabeten sein oder nur eine geringe Ausbildung bekommen haben. 31Wenn Paulus hier die geistgewirkten Fähigkeiten des Redens und der Erkenntnis hervorhebt, wird deutlich, wie sehr die messianische Gemeinschaft die Beteiligten beschenkt.
1,5 1,5Sie gewinnen die Fähigkeit, freimütig öffentlich zu sprechen (logos) , sowohl in der Gemeinde als auch in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit (14,24). Kapitel 14 zeigt, welche Bedeutung das öffentliche Reden in der Gemeinde hat. Der Brief zeigt durchweg, dass bei den Angeredeten Erfahrung und Kompetenz in der Auslegung der Schrift vorausgesetzt werden kann. Dass Paulus diese Fähigkeiten und Kompetenzen auf Männer beschränkt wissen will (14,34), ist durch nichts angedeutet und schon deshalb ist 14,34 – das Redeverbot für Frauen in der Gemeindeöffentlichkeit – nicht als Votum des Paulus anzusehen (s. zu 14,34). Die Gabe des logos umfasst Sprache und Vernunft, eine Vernunft, die in der Gesellschaft als exklusive Fähigkeit der Elite in der Gesellschaft angesehen wurde, da sie zum Planen, Gestalten und Regieren befähigt. Die Erkenntnis (gnosis) wird nicht nur intellektuelle Fähigkeiten meinen, sondern auch von der Geistkraft gewirkte: Erkenntnisse zu empfangen und weiterzugeben, die aus göttlicher Offenbarung stammen.
1,6 1,6„Ihr bezeugt den Messias und darin beweist ihr zunehmend Stärke.“ Die Übersetzung der Lutherbibel 1984 lautet: „Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden.“ Hier bleibt offen, wer predigt oder Zeugnis ablegt. In der Auslegungstradition gibt es darüber den Konsens: Paulus. Damit wird oft die Deutung des Wortes ebebaiothe / [das Zeugnis wird] gefestigt oder gestärkt als passivum divinum verbunden. 32Durch diese Deutung wird die Gemeinde ausschließlich als Objekt gesehen. Doch in 1,5 ging es um ihre Fähigkeiten und Aktivitäten. 1,6 ist im Griechischen ein Nebensatz und beginnt mit kathos , was hier wohl „entsprechend“ bedeutet. Inhaltlich will dieser Nebensatz die Begabung mit geistgewirkten Fähigkeiten als Prozess deutlich machen. Dieser geht mit dem Bezeugen (martyrion) einher, dass durch den Messias Jesus Befreiung von der Einbindung in Gewalt und Zerstörung geschieht. logos und gnosis bedeuten inhaltlich: das Zeugnis vom Messias Jesus, das die Gemeinde öffentlich ablegt. Dazu gehören Mut und Stärke, die von Gott bewirkt werden (s. die obige Übersetzung, die für ebebaiothe die Deutung als passivum divinum offenhält).
Читать дальше