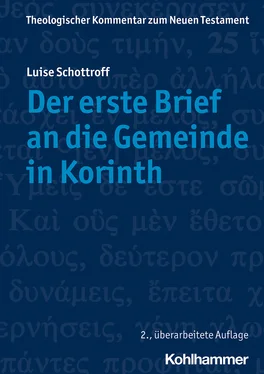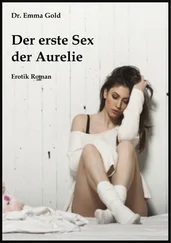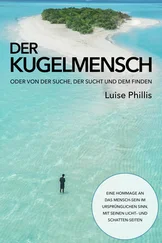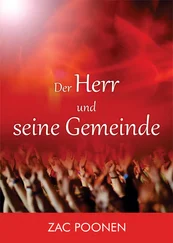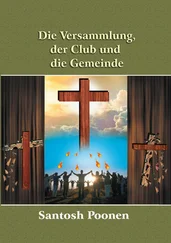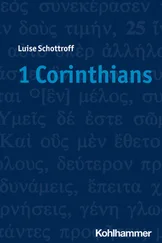2. Paulus und der Messias
Der Messias ist von Gott erweckt worden, als die Weltmacht Rom ihn gekreuzigt hatte. Als Paulus von Gott für das Evangelium der Völkerberufen wurde, begann er seinen Weg als Beauftragter Gottes, als Apostel (s. zu 1,1). Er versteht seinen Auftrag als Teil eines weltweiten Geschehens (s. 16,5–9), als Teil der Arbeit in einem Netzwerk, zu dem immer mehr Menschen gehören. Es geht ihm nicht darum, eine Kirche oder Religion zu stiften, sondern darum, die Befreiung von der Sklaverei des Todes und der Sünde in der damaligen Welt ausbreiten zu helfen. Für ihn geschieht diese Ausbreitung, wo Menschen sich zusammentun und gemeinsam in der Tora forschen, wie ihr Weg zur Gerechtigkeit Gottes aussehen kann. Der Begriff „Mission“ ist nur verwendbar, wenn er von dem Anspruch, einer Institution oder einer Lehre zur Macht zu verhelfen, freigehalten wird.
Mit der Erweckung des gekreuzigten Jesushat Gott dem Tod und der Gewalt ein Ende gesetzt. Diese Botschaft ist Grundlage des Evangeliums, wie Paulus es in die Mittelmeerwelt trägt. Das römische Reich setzte seine Herrschaft durch offene und subtile Gewalt durch. Zu dieser Gewalt gehörten Kreuzigungen als Mittel der politischen Abschreckung, aber auch „Spiele“, d. h. Massenveranstaltungen in vielen Städten, in denen Menschen gefoltert und getötet wurden (s. 4,9). Die Massen sollten eine scheinbare Mitwirkung an großen Entscheidungen über Tod und Leben erleben und der Gewalt in den Arenen zujubeln. Wer diese Zustimmung zur Gewalt nicht mitmachte, war gefährdet, von Rom verfolgt zu werden. Die Angst vor Verfolgung hatte deshalb auch Menschen, die bereits zu den Gemeinschaften des Gottes Israels (ekklesiai theou) gehörten, dazu gebracht, die Kreuzigung ihres Befreiers zu verleugnen, also das Wort vom Kreuz zu verschweigen (s. 1,17.18), und ebenso auch die Auferweckung des Messias. Rom hatte bereits vor dem Auftreten des Juden Jesus, der von vielen Menschen als Gottes Befreier / Messias angesehen wurde, messianische Bewegungen verfolgt (s. Basisinformation vor 15,1). Paulus kämpft dafür, dass die Gemeinden Gottes in der Frage ihrer Zugehörigkeit zu einem Gekreuzigten, der von Gott zum Messias gemacht wurde, eindeutig blieben. Denn die Versammlung oder Gemeinde Gottes versteht er als Körper des Messiasin dieser Welt. Die Vorstellung vom kollektiven Körper, mit dem Gott in der Welt handelt, ist nicht metaphorisch zu verstehen (s. zu 12,12.27). Die Gemeinde verkörpert mit allen ihren Gliedern den Messias und handelt messianisch, nach innen und nach außen. Sie nennt die Gewalt öffentlich beim Namen und baut eine Gemeinschaft auf, die Gottes Gerechtigkeit verwirklicht. Die Gerechtigkeit befreit die Sexualität aus ihrer Gewaltförmigkeit (s. 6,12–20; 7,1–40), sie gibt den Armen gleiche Rechte und unterbindet Privilegien der Reichen auf Kosten anderer Menschen (1,26–31; 11,17–34). Auch Frauen erhalten gleichrangige Würde mit Männern (s. 11,2–16). Die ethnische Vielfalt, die vielen Muttersprachen der Gemeindeglieder sollen nicht zugunsten der Verkehrssprache verschwiegen werden. Es wird um eine Form gerungen, wie sie öffentlich neben der Prophetie (in der Verkehrssprache) in der Gemeinde gehört werden können (Basisinformation bei 14,1).
Der Körper des Messias, Jesu Körper, und die einzelnen Körper der Menschen sind Ort der Gegenwart Gottes (11,23; 12,12.27; 6,19). Im Abendmahl sind diese unterschiedlichen Dimensionen des Begriffs „Leib Christi“ (soma Christou) untrennbar miteinander verbunden. Das Abendmahl ist der Ort der immer wieder erneuerten Vergegenwärtigung der körperlichen Gegenwart Gottes und des Messias.
3. Paulus unter seinen Geschwistern
Paulus versteht sich als ein Ausleger der Tora in Gemeinschaft. Auch die Menschen aus den Völkern haben schnell große Kompetenz erworben, die Tora zu kennen und für ihr Leben in der Gemeinschaft des Leibes Christi auszulegen. Paulus hatte Anteil an diesen Auslegungsgemeinschaften. Er bekommt keine Sonderrechte (s. 5,3–5), wenn die Versammlung auf der Grundlage der Tora Entscheidungen fällt.
Paulus war nicht der einzige von Gott gesandte Bote des befreienden Evangeliums. Seine Briefe sind meist mit anderen Menschen gemeinsam geschrieben (s. 1,1) und enthalten vieles von der Sprache der Gemeinden, ihren Gebeten und Diskussionen. Paulus „hatte“ nicht „Mitarbeiter“, die er dirigierte, sondern arbeitete mit anderen Geschwistern gemeinsam für das Evangelium (16,1–24). Im Leib Christi sollte es keine Beziehungen von oben nach unten geben. In der Auslegungsgeschichte ist Paulus vielfach als Gestalt, die Macht über andere hat, die Lehrdifferenzen mit Autorität entscheidet und die Gemeinde „ermahnt“ (s. 1,10), verstanden worden. Diese Paulusdeutung hat sein Bild nachhaltig geprägt – gerade auch durch entsprechende Wortwahl in Bibelübersetzungen. So wurde er zur Identifikationsfigur für Leitungsleute, die Herrschaft in der Kirche beanspruchten. Zugleich aber verbreitete dieser Paulus auch Furcht und Abwehr bei denen, die unter Hierarchien litten und an gerechten Beziehungen in der Kirche arbeiteten.
Frauen in den Gemeinden waren für Paulus gleichwertige Arbeiterinnen für das Evangelium. Aber wenn es um Frauen und ihre Sexualität und Beziehungen zum anderen Geschlecht geht, wird seine Ambivalenz ihnen gegenüber sichtbar. Er will zwar nicht, dass messianische Männer zu Prostituierten gehen. Die Prostituierten selbst bleiben dabei für ihn aber nahezu unsichtbar. Und es bleibt unsichtbar, dass ein relevanter Teil der Gemeinden aus Frauen besteht, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise durch Prostitution verdienen mussten. Für die Paulusrezeption im 21. Jahrhundert sollte eine Wiederentdeckung des Bruders Paulus begleitet sein von der offenen Aussprache über seine Ambivalenz in bestimmten Fragen. Paulus verbreitete auch Vorstellungen, die in der Geschichte der Kirche und der von ihr beeinflussten Gesellschaften Frauen und Männer unterdrückt und gequält haben. Das gilt besonders für Menschen, die gleichgeschlechtlich leben (6,9), und für Frauen in patriarchalen Ehen (7,10.36). Die unterdrückerische Seite des Paulus ist durch die Auslegungstradition noch zusätzlich verstärkt worden. Die Kritik an Paulus sollte in den Gemeinden des 21. Jahrhunderts, auch in Gottesdiensten, besprochen werden.
4. Der Alltag in den Städten des römischen Reiches
Paulus redet relativ häufig von seinen eigenen Lebensbedingungen. Er muss hart arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er ist vor allem auf seinen endlosen Fußmärschen durch die Weiten der nördlichen Mittelmeerländer Gefahren ausgesetzt (4,12; 16,5–9). Er ist zudem andauernd in politischer Gefahr. Als Fremder braucht er Schutz in den Städten. Römische Behörden in den Städten und z.T. auch die Bevölkerung sind schnell bereit, Verkünder eines Gottesfriedens, der sich von dem Frieden der pax romana grundlegend unterscheidet, zu verfolgen, verprügeln, zu verhaften und mit dem Tod zu bedrohen (4,11–13).
Die Lebensbedingungen der Mehrheitsbevölkerungin den Städten werden in vielen Einzelheiten dieses Briefes erstaunlich deutlich. Paulus redet von Armut und von mangelnder Bildung (1,26–31). Er kritisiert die Rhetorik der öffentlichen Veranstaltungen (2,1–5) und wohl auch die Prügel für Kinder in den Schulen (4,21). Er spricht sachkundig über Architektur (3,9–17), über Gerichtsbarkeit und über die Vielsprachigkeit der Städte und ihre Probleme (14). Viele Aspekte des antiken Stadtlebens lassen sich in diesem Brief entdecken. Erschütternd ist dabei die Präsenz der Gewalt im Alltag, vor allem der Gewalt in den Massenveranstaltungen (4,9–13) und im Umgang mit Sklavinnen und Sklaven (7,21–24).
Читать дальше