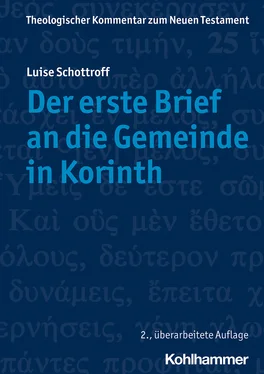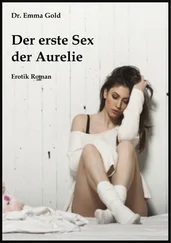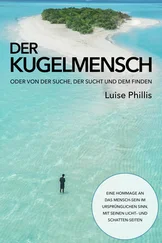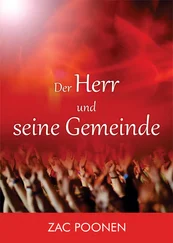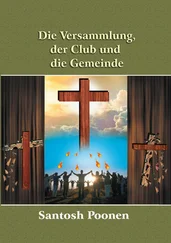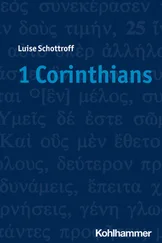2,2 2,2Bewusst und nachdrücklich hat Paulus bei seinem ersten Auftreten in Korinth den Messias Jesus in den Mittelpunkt gestellt, und zwar als Gekreuzigten. Er erwähnt hier nicht, dass Gott den gekreuzigten Messias erweckt hat, dass er ihn nicht dem Tod und der Gewalt überlassen hat. Doch ohne dieses Gotteswunder bleibt die Kreuzigung Jesu ein Zeichen politischer Unterdrückung zur Abschreckung der Bevölkerung. Dass Paulus hier die Kreuzigung so isoliert als Inhalt seiner Botschaft nennt, ist im Zusammenhang von 1,17–25 verständlich. Der öffentlichen Solidarität mit dem Gekreuzigten und damit den vielen Gekreuzigten darf nicht aus dem Weg gegangen werden (s. o. Basisinformation Verleugnung der Kreuzigung). Doch seine Botschaft erschöpft sich schließlich nicht in der Mitteilung der puren Tatsache der Kreuzigung. Deshalb vergegenwärtigt die Botschaft, die von Jesu Kreuzigung erzählt, in den Gemeinden bereits als solche machtvoll die Auferstehung und den Auferstandenen – auch ohne explizite Worte dazu.
2,3 2,3Paulus spricht hier sehr persönlich: Damals, als er zu der Gemeinde kam (s. 2,1), kam er „in Schwäche“. Wenn er sich in 2,3 auch wie in 2,1 auf die Situation seines Anfangs in Korinth bezieht, was sprachlich möglich ist, entsteht die Frage, ob er sich tatsächlich als Gründerder korinthischen Gemeinde versteht, weil er hier die Existenz einer Gemeinde schon für seinen Beginn voraussetzt. In 3,6 vergleicht er seine Anfangsarbeit mit einem Pflanzen, in 3,10 mit dem Legen eines Fundamentes, in 4,14.15 nennt er sich Vater, der die Gemeinde geboren oder gezeugt hat (vgl. Gal 4,19). Widersprechen diese Aussagen Apg 18,2–4? Dort wird berichtet, dass Paulus bei seinem Aufenthalt in Korinth bei dem Ehepaar Prisca und Aquila wohnt. Es gibt Gründe zu vermuten, dass sie bereits vor seiner Ankunft Teil einer messianischen Hausgemeinde in Korinth sind (s. zu 16,19). So könnte Paulus’ Arbeit in Korinth auch in dieser Gemeinde ihre erste Basis gehabt haben. Seine Formulierungen in 1 Kor 3,6.10; 4,14.15 müssen dem nicht widersprechen: Er hat in jedem Fall Entscheidendes zum Aufbau der Gemeinde beigetragen. Ihn als Gründer der Gemeinde zu bezeichnen ist der kirchlichen Auslegungstradition wichtiger als ihm selbst.
Seine Schwächeist für Paulus eine immer wiederkehrende Sorge. 126Er muss eine schwere chronische Krankheit gehabt haben. Was es genau war, das ihn so hinfällig machte, ist nicht zu erkennen. Wo er seine Schwäche erwähnt oder beklagt, spricht er zugleich von der Erfahrung der Kraft Gottes – gerade in den Stunden der Schwäche. So auch hier. Trotz seiner Schwäche in der Anfangszeit in Korinth war seine Verkündigung voller Geistkraft und Machterweise Gottes (2,4.5). So wiederholt sich an seinem Körper das Geschick Jesu, der am Kreuz starb und von Gott neu ins Leben gerufen wurde (vgl. 2 Kor 4,10). Die Lebendigkeit und Gegenwart des Messias ist ein Gotteswunder, das sich im Leben der Menschen wiederholen kann, im Leben des Paulus wie in dem der Gemeinde (1,26–31). Die Wendung „ Furcht und Zittern“ nimmt alttestamentliche Sprache auf. Sie kann sich auf die Ehrfurcht vor der Macht Gottes beziehen (Jes 19,16; Ex 15,16; Dtn 11,25), aber auch auf das Erschrecken, das Gewalt unter Menschen auslöst (Ps 55,6). Doch ist die Wendung hier auf das Auftreten des Paulus bezogen und verdeutlicht seine Erfahrung der Hinfälligkeit: Er hatte Angst, zu versagen, seine Aufgabe nicht erfüllen zu können. In der Auslegungsgeschichte finden sich theologische Verallgemeinerungen für die Beschreibung der Schwäche und Angst des Paulus, z. B. als „demütige Hinnahme […] des Willens Gottes“, 127als Abhängigkeit von Gott. Damit wird die physische und psychische Not zur Nebensache. Paulus geht es hier nicht um die Demut und Christusförmigkeit der verkündigenden Menschen, sondern um eine persönliche Erfahrung von Not, an die die Gemeinde in Korinth sich erinnert.
2,5 2,5Im Griechischen beginnt 2,5 mit „hina“ , meist so übersetzt: „ damit“ euer Glaube (z. B. nicht auf Menschenweisheit stehe). Wie oft in der neutestamentlichen Sprache bezeichnet das griechische hina hier jedoch nicht Ziel oder Zweck, sondern die Folge. 128Wenn hina final gedeutet wird, ergibt sich, dass es Gottes (oder des Paulus) Absicht war, Paulus mit mangelnder Redekunst und in Krankheit vor die Gemeinde zu stellen; seine Schwäche wäre dann Mittel zum Zweck. Damit entstehen absurde Konsequenzen, z. B. dass Gesunde für die Kreuzesverkündigung ungeeignet seien. Es ist wichtig, die individuelle Not dieses Menschen Paulus als das zu nehmen, was er über sie sagt: als große Belastung und Behinderung. Dass die Gemeinde trotzdem durch diese Verkündigung Vertrauen zu Gott gewann, ist ein von Gottes Macht gewirktes Wunder. Die pistis ist das Vertrauen darauf, „dass Gott die Toten lebendig macht“ (Röm 4,17). Die Übersetzung des Wortes mit „Glauben“ kann missverständlich sein, z. B. im Sinne eines Für-wahr-Haltens von bestimmten Lehren. 129
Basisinformation: Das „Wir“ der Gemeinde
In den paulinischen Briefen wechselt Paulus häufig von der Anrede in der 2. Person Plural, die der Form eines Briefes an eine Gemeinde entspricht, in ein „Wir“. So auch in 1 Kor 2,6. 130Gott ist Vater dieser „Wir“, und der Messias ihr Befreier (1,3.8.9.10). Diese „Wir“ sprechen das Sch’ma Israel (8,6; vgl. Dtn 6,4) und setzen damit den Gewalten (8,5) eine Grenze. Die „Wir“ sind Menschen, die von Gott Kraft und Weisheit erhalten (1,18.30). Sie sind es, die Gott lieben (2,9) und von Gott gerettet werden (1,18). Sie empfangen die Offenbarung Gottes (2,10.12) und geben sie weiter (2,6.13 vgl. 1,5). Sie sind mit göttlichem Verstand begabt (2,16).
In Kapitel 10 setzt Paulus die „Wir“ seiner Gegenwart in Beziehung zu Israel in der Wüste. Die „Wir“ lernen von „unseren Vätern und Müttern“, die aus Ägypten auszogen (10,1). Diese „Wir“ der Gegenwart sind das soma Christou (10,16; 12,27). Paulus schließt sich selbst in dieses „Wir“ mit ein. In 10,11; 1,18; 2,6 definiert er das „Wir“ eschatologisch. Er nennt sie: „die gerettet werden“ / sozomenoi (1,18). Das Urteil im Gericht Gottes, über das niemand etwas wissen kann, ist für sie eine Hoffnung und Kraftquelle. Sie erleben jetzt schon den Anfang vom Ende der Gewalt und der Macht der „Aionen“ dieser Welt (10,11; s. dazu schon oben Basisinformation Zeitvorstellungen bei 1,7). Darum ist das Wir der Gemeinde mit dem Messias Gottes identisch geworden und ist als Leib Christi die Autorität, an der sich die Legitimität aller einzelnen Botschafterinnen und Botschafter Gottes entscheidet (3,17.22.23).
Sätze wie diese zeigen, dass der Leib Christi / das soma Christou in der Gegenwart und im Alltag der Welt und ihrer Gewaltstrukturen der Messias ist . Die emphatische Rede über die „Wir“ schließt nicht aus, dass Paulus die Gemeinde nicht auch scharf kritisiert.
6 Wir reden dennoch von Weisheit, Weisheit unter den Vollkommenen. Dies ist aber eine Weisheit, die nicht von dieser Welt abhängt und auch nicht von den Herrschenden dieser Welt. Sie sind dabei, ihre Macht zu verlieren. 7 Wir reden von göttlicher Weisheit, im Geheimnis verborgen, die Gott vor aller Zeit bereitet hat, um uns an der göttlichen Gegenwart teilhaben zu lassen. 8 Niemand von den Herrschenden dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie die Weisheit erkannt hätten, hätten sie den Repräsentanten der göttlichen Gegenwart nicht gekreuzigt. 9 Vielmehr ist es gekommen, wie es geschrieben steht: Was kein Auge sah und kein Ohr hörte und was in keines Menschen Herz hinaufstieg, das hat Gott denen, die sie lieben, bereitet. 10 Uns hat es Gott durch die Geistkraft enthüllt. Die Geistkraft ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. 11 Welche Menschen können andere Menschen verstehen, wenn nicht Menschengeist in ihnen ist? So versteht auch niemand Gott ohne Gottes Geistkraft. 12 Wir haben nicht den Geist der Welt erhalten, sondern die Geistkraft, die von Gott kommt, damit wir verstehen, was Gott uns geschenkt hat. 13 Diese Erfahrung geben wir weiter, nicht in der gelehrten Sprache menschlicher Weisheit, sondern in der Sprache, die die Geistkraft lehrt. Den Menschen, die von der Geistkraft erfüllt sind, öffnen wir die Geschenke der Geistkraft. 14 Menschen, die einfach vor sich hin leben, nehmen das Geschenk der göttlichen Geistkraft nicht an, weil sie das für unklug halten. Sie können das Geschenk nicht erfassen, denn es kann nur mit Hilfe der Geistkraft zur Wirkung kommen. 15 Die von der Geistkraft Erfüllten aber befragen alles, ihr göttlicher Geist jedoch kann von keinem Menschen bewertet werden. 16 Denn: Wer hat die Gedanken der Ewigen erkannt, wer will sie belehren? Wir haben Gedanken der Ewigen.
Читать дальше