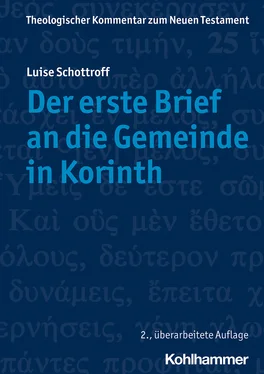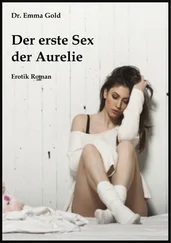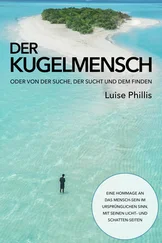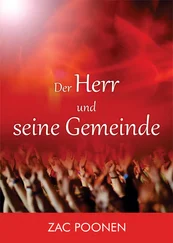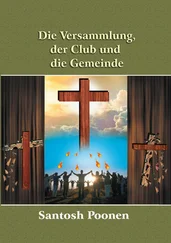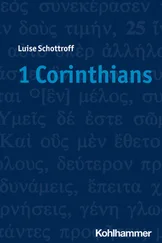1,30 1,30In 1,30 breitet Paulus den ganzen Reichtum aus, in dem die Messiasgläubigen als Gemeinschaft leben. Diesen Reichtum haben sie von Gott erhalten, der sie zum Leib Christi machte. Die bei Paulus häufige Wendung en Christo Jesu blickt gleichzeitig auf Gottes Handeln, der einen von Rom Gekreuzigten auferweckt, und auf das Ergebnis des Handelns Gottes: Die Gegenwart des Messias in Gestalt einer Gemeinschaft von Menschen an einem konkreten Ort, Korinth, und an vielen anderen. Die Wendung ist fast gleichbedeutend mit der paulinischen Rede vom Leib Christi (soma Christou) . Die ungebildeten und erniedrigten Menschen, die in Korinth Leib Christi sind, haben nun Weisheit von Gott(vgl. 1,24; s. zu 1,5 und Basisinformation nach 1,25): Sie erkennen Gottes Handeln in Korinth, sie leben nach der Tora (s. zu 7,19) und sie bilden eine Tora-Auslegungsgemeinschaft von großer Kompetenz, auch wenn sie mehr oder weniger Analphabeten und Analphabetinnen sind.
Gerechtigkeit– die „uns“ Gott als Geschenk zuwendet, obwohl auch die Hafenarbeiter und Straßenhändlerinnen in Korinth sehen, wie sehr sie in Strukturen des Unrechts verstrickt sind. Sie erleiden Unrecht durch Machtmissbrauch, sind also Opfer. Aber sie sind selbst auch Täter und Täterinnen. Das Geschenk der Gerechtigkeit führt die Messiasgläubigen in die Erfüllung der Tora. Zwischen „unserer“ Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit Gottes zu unterscheiden, verhindert, den Zusammenhang von beiden zu erkennen. Gottes Gerechtigkeit ist sein befreiendes Handeln, dass die Messiasgläubigen fähig macht zum Halten der Tora.
Heiligung– durch die Gemeinschaft mit Christus werden die Menschen zu Heiligen (s. o. zu 1,2).
Befreiung– vgl. Röm 3,24. Das hier verwendete Wort apolytrosis bezieht sich in der gesellschaftlichen Realität auf den Loskauf von Gefangenen durch Lösegeld, 118aber das Wort bringt zugleich die Befreiung des versklavten Volkes Israel aus Ägypten in Erinnerung. 119Das zeigt sich daran, dass die Metapher nicht an der Frage orientiert ist, was denn nun der Kaufpreis war. Gottes Handeln hat die Messiasgläubigen aus der Sklaverei befreit. Im Zusammenhang von 1 Kor 1,30 ist dabei an die Befreiung von den Strukturen dieser Welt zu denken, die im Römerbrief „Sünde“ genannt werden. Das Leben unter den Bedingungen des römischen Reiches wird auch für Freigeborene als Sklaverei bezeichnet. 120Dass der korinthischen Gemeinde Sklavinnen und Sklaven angehören ist eindeutig, auch wenn der Nachweis im Einzelnen schwierig ist. Personennamen und Gruppenbezeichnungen (die Leute der Chloë 1,11; das Haus des Stephanas 1,16) können auf Versklavung hindeuten. 121
Wenn also die Zugehörigkeit zum Messias in 1,30 apolytrosis bringt, dann ist Befreiung von der Sklaverei im Sinne der strukturellen Sünde und des Lebens in einem System der Gewalt gemeint. Befreiung vom rechtlichen Status der Versklavung für Sklavinnen und Sklaven ist damit nicht gemeint, wohl aber ein Leben als „Freigelassene Christi“ (7,22). Sie sind den Freigeborenen in der Gemeinde gleichgestellt. Die Gemeinde arbeitet gemeinsam für eine Lebensgestaltung in der Gemeinde und darüber hinaus, die der Weisheit der Welt und ihrer Lebensfeindlichkeit ein Ende setzt.
1,31 1,31Paulus führt einen Satz, der in Anlehnung an Jer 9,23 (LXX) bzw. 1 Sam 2,10 (LXX) formuliert ist, als Schriftzitat ein. Paulus hat andere Vorstellungen vom Zitieren als die gegenwärtige historische Wissenschaft (s. Basisinformation bei 7,19). Die Einführung des Zitates ist ebenfalls ein Kürzel, er sagt nur hina kathos und deutet seine Schrifthermeneutik an: Gott rede in der Schrift „unseretwegen“ (Röm 4,23.24; 1 Kor 9,10). Gottes Wort in der Schrift soll von „uns“ (s. Basisinformation vor 2,6) gelebt werden. Sich des kyrios rühmen / den kyrios preisen – hat zu unterschiedlichen Deutungen geführt: Ist Gott oder Christus gemeint? Paulus hat den Satz als Schriftzitat verstanden wissen wollen, deshalb sollte er auf Gott gedeutet werden und kyrios als Platzhalterwort des Tetragramms. 122Gott zu loben ist die wahre und unerschöpfliche Kraftquelle – nicht aber eigenen Besitz oder Bildung gegen Andere auszuspielen.
2,1–16 2,1–16besteht aus zwei Abschnitten, die inhaltlich aufeinander bezogen sind. Der erste Abschnitt 2,1–5 setzt das Leben des Paulus, speziell sein Auftreten als Bote Gottes vor der Gemeinde, in Bezug zur Kreuzesnachfolge der Gemeinde (1,26–31). Die Botschaft Gottes (katangellein 2,1; kerygma 2,4), die er überbringt, ist Offenbarungsrede (2,1) und Rede, in der göttliche Kraft wirkt (2,5). In 2,6–16 wird die Offenbarungsrede in ihrer grundsätzlichen Bedeutung erklärt. Auch die Gemeinde wird nun zum Subjekt der Offenbarungsrede. Schon das „Wir“ in 2,6 schließt Paulus als Boten Gottes mit der Gemeinde zusammen. Dieser Abschnitt spricht von dem unendlichen Reichtum der Erfahrung von Gottes Geistkraft und Weisheit in einer Gemeinde, die sich von der „Weisheit der Menschen“ (2,5), der „Weisheit dieses Äons“ (2,6), dem „Geist dieser Welt“ (2,12.13) trennt. Diese Trennung hat große Folgen für die Lebenspraxis (s. o. zu 1,2). Die Weisheit und Geistkraft, die von Gott kommt, macht die Gemeinde fähig, die Kreuzigung Jesu als Gewalttat der Mächtigen zu durchschauen, die der Logik der „Weisheit dieses Aions“ folgt (2,6–8). Und: Sie macht sie fähig, den eigenen Reichtum, den Gottes Geistkraft bringt, zu bejubeln: Wir haben den Geist Gottes (2,16).
1 Als ich zu euch kam, Geschwister, trat ich auch nicht als glänzender Redner und Weisheitslehrer auf, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. 2 Denn ich kam zu der Überzeugung, dass bei euch nichts so wichtig sei wie der Messias Jesus, und zwar als Gekreuzigter. 3 Ich kam zu euch in Schwäche und Furcht und mit großem Bangen. 4 Meine Rede und meine Botschaft bestanden nicht aus gewinnenden Weisheitsworten, sondern kamen aus der Erfahrung von Geist und gottgegebener Kraft. 5 So beruht euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes.
2,1–4 2,1.4In den Abgrenzungen von einem „Übermaß“ an Redekunst oder Weisheit im Sinne der gesellschaftlichen Normen wiederholt Paulus, was er schon in 1,17.20 gesagt hat: Es gibt in der Gesellschaft Korinths – wie überhaupt der hellenistischrömischen Öffentlichkeitskultur – eine Redekunst, die der Selbstdarstellung und der Ideologie des Imperium dient. 123Solche öffentliche Rede ist das Feld auch für die Bewährung von Männlichkeit, die dem Herrschaftssystem Ausdruck geben und ihm dienen soll. Es geht hier bei dieser Abgrenzung nicht um Gegner / Gegnerinnen des Paulus in der Gemeinde, sondern um die notwendige Distanz des Paulus und der Gemeinde zu einer öffentlichen Kultur, die der Gewalt dient.
Schon das erste Wort dieses Abschnittes kago / auch ich schließt Paulus und die Gemeinde zusammen. In 2,3 nimmt er es noch einmal auf. Sie sind eine Gemeinde aus Ungebildeten, die Gottes Weisheit leben, und so tritt auch Paulus auf. Was ist damit gemeint? Paulus verfügt zweifellos über eine gründliche Ausbildung als Ausleger der Tora bei einem berühmten pharisäischen Lehrer in Jerusalem, Gamaliel (vgl. Apg 22,3). Er verfügt jedoch nicht über ein besonderes rhetorisches Charisma oder eine Ausbildung im öffentlichen Reden und Auftreten. In 2 Kor 10,10 zeigt sich, dass es Gemeindemitglieder gibt, die kritisieren, dass sein Auftreten schwach sei. 124Es scheint ihnen, dass er sich hinter seinen Briefen versteckt, denn sie „wiegen schwer und sind voller Kraft“ (BigS). Es sind Zweifel angebracht, ob die Briefe, die ja in der Versammlung vorgelesen wurden, damals leicht verständlich waren, auch wenn die Gemeinde vieles in ihnen wiedererkennen konnte. Doch es bleibt das Faktum, dass er am Aufbau messianischer Gemeinschaften im Imperium Romanum maßgeblich beteiligt war, also trotz mangelnder rhetorischer Bildung durch seine „counter-rhetoric“ 125viele Menschen erreicht und für ein neues Lebensziel gewonnen hat.
Читать дальше