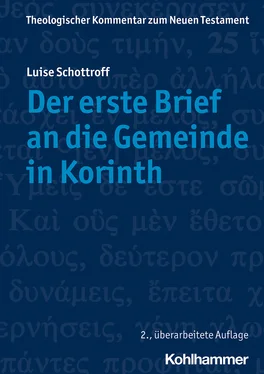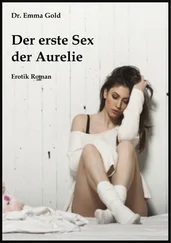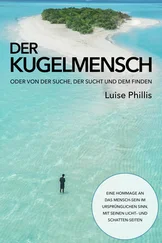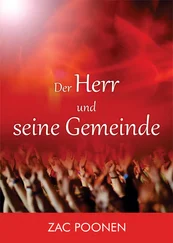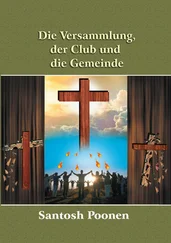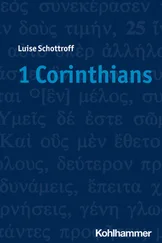Die Messiasgläubigen aus den Völkern verpflichten sich also auf die Einzigkeit des Gottes Israels (8,4–6) und auf das Halten der ganzen Tora (7,19). Israels Vorfahren werden auch zu ihren Vorfahren (10,1) – doch sie gehören weiterhin einem anderen ethnos an.
Aus der Perspektive von außen werden sie später christianoi bzw. christiani genannt. 93Diese Bezeichnung bedeutet, dass sie von außen als jüdisch-messianische Gruppe verstanden werden, wie es schon vorher und neben ihnen auch andere im Judentum gab. Als solche werden sie auch von Rom verfolgt, denn es gibt eine kontinuierliche Politik römischen Misstrauens gegen jüdischen Messianismus. 94Das Wort christianoi bzw. christiani sollte in Texten des ersten und beginnenden 2. Jahrhunderts mit „Messiasanhängerschaft“ übersetzt werden. Das Wort christlich impliziert eine Abgrenzung vom Judentum, die es weder von innen noch von außen gab.
Die Frage nach der Identität der Messiasgläubigen in Korinth erlaubt keine einfache Antwort. Menschen aus nichtjüdischen Völkern leben jüdisch und binden sich uneingeschränkt an den Gott Israels. Die Frage nach ihrer Identität im Sinne von inneren und äußeren Behörden hat offensichtlich niemand gestellt. Dazu passt, dass auch die Frage, was eigentlich einen Judaios ausmacht, nicht Gegenstand von Definitionen war, sondern wenn sie überhaupt gestellt wurde, durch Aufzählungen von Aspekten der Lebenspraxis beantwortet wurde. 95
Im Blick auf die spätere christliche Geschichtsschreibung, auch über die Gemeinde in Korinth, ist klar festzustellen: Die von christlicher Seite später betriebene Abgrenzung von Judentum wird zwar oft schon in die Zeit des 1. Jahrhunderts hineinprojiziert, aber dieses Geschichtsbild ist falsch. Eine Abgrenzung vom Judentum gab es weder bei den Messiasleuten aus den Völkern noch wurde ihnen gegenüber eine Abgrenzung durch jüdische Mitglieder der Synagoge, die den Messias Jesus ablehnten, betrieben. Auch von römischer Seite waren beide Gruppen demselben gesellschaftlichen Druck und politischen Misstrauen ausgesetzt. Die Trennungspolitik war dann im 2. Jahrhundert das Werk einiger „Kirchenväter“. 96
Erst für den fiscus Judaicus nach der jüdischen Niederlage gegen Rom im Jahre 70 n. Chr. haben römische Behörden das Interesse gehabt, genau zu wissen, wer jüdisch ist und wer nicht. 97In diesem Zusammenhang tauchen auch kurze Beschreibungen von Leuten auf, die auf Messiasgläubige aus den Völkern passen könnten: „inprofessi Judaicam viverent vitam / Leute, welche, ohne sich zum Judentum zu bekennen, nach jüdischem Ritus lebten“; 98Cassius Dio berichtet von zwei Verwandten des Kaisers, die wegen Atheismus verurteilt wurden und schließt dann eine allgemeine Notiz an über „alloi es ta tou Joudaion ethe exokellontes / andere, die sich in jüdische Lebensformen hineintreiben ließen“. 99Auch wenn nicht genau zu erschließen ist, ob es sich um Messiasgläubige aus den Völkern handelt oder um andere Leute aus den Völkern, die mit dem Judentum sympathisieren, sind diese Notizen für 1 Kor interessant. Sie zeigen, wie der Blick von außen auf solche Gruppen aussieht.
Shaye Cohen (1999, 140–174) hat sechs heuristische Kategorien für die „Beginnings of Jewishness“ / Anfänge des Jüdischseins aufgelistet (z. B. die Macht des jüdischen Gottes anerkennen oder / und einige oder mehrere jüdische Rituale praktizieren). Sie zeigen, wie wir uns den Weg von Menschen aus den Völkern vorstellen können, die in irgendeiner Weise jüdisch lebten ohne jüdisch zu sein. Es waren unorganisierte, undefinierte und dezentrale Prozesse. Der Befund für die korinthische Gemeinde fügt diesem Bild nur eine Variante hinzu, eine Variante unter vielen, die aber insgesamt ins Bild passt.
26 Seht doch auf euch, Geschwister: Ihr seid gerufen. Es sind nämlich unter euch nicht viele Gebildete von ihrer Herkunft her, nicht viele Mächtige, nicht viele aus den Elitefamilien. 27 Vielmehr hat Gott die Ungebildeten der Welt erwählt, um die Gebildeten zu beschämen; und die Schwachen der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu beschämen. 28 Und die Geringen und die Verachteten der Welt hat Gott erwählt, die, die nichts gelten, um denen, die etwas sind, die Macht zu nehmen. 29 Das geschieht, damit kein Mensch vor Gott überheblich ist. 30 Durch Gott seid ihr mit dem Messias Jesus verbunden, der uns von Gott her zur Weisheit befähigt und zur Gerechtigkeit und Heiligung und Befreiung. 31 So geschieht, was geschrieben steht: Wer groß sein will, preise die Größe der Ewigen.
Die Biografie der geschwisterlichen Gemeindeglieder in Korinth ist selbst ein Zeugnis der Auferweckung des Gekreuzigten. „Seht doch“ beginnt der Text: An euch selbst ist das Eingreifen Gottes in die Gewaltstrukturen sichtbar. Gott hat diejenigen gerufen, die in der Stadt Korinth unten sind: Ungebildete, politisch Machtlose und Menschen, die schon durch ihre Herkunft auf die Verliererseite der Gesellschaft gehören; „Nichtse“ aus der Perspektive von oben – so fasst 1,28 zusammen. Die Verwandlung, die Gottes Eingreifen gebracht hat, bedeutet für diese „Nichtse“, dass sie Leib Christi geworden sind (1,30a) und Christi Weisheit in ihnen Gestalt gewonnen hat. Er hat ihnen Bildung, Gerechtigkeit, Heiligung und Befreiung gebracht (30b; s. schon 1,5). Die Gebildeten und Mächtigen verlieren in diesem Geschehen ihre Macht (1,27–29). Sie können sich nicht mehr wegen ihrer Besitztümer brüsten (1,29). Was bedeutet das konkret?
Paulus greift in diesem Text auf die biblische Tradition zurück: Die Erwählung der Armen durch Gott und die Erwählung des kleinen Israel (s. nur 1 Sam 2,7–10; Dtn 7,6–8). Er legt die Schrift für die Gegenwart aus; er bezieht sie auf die Erfahrungen der Menschen in der korinthischen Gemeinde. Explizit bezieht er sich auf Jer 9,22.23 (in 1,29.31), implizit auf den breiten Traditionsstrom des Evangeliums der Armen in der Schrift (in 1,26–28).
1,26 1,26Gott hat Menschen in Korinth gerufen (klesis), er hat sie erwählt (1,27.28). Sie sollen auf Gottes Handeln schauen, auf Gottes Rufen und Erwählen. Wie im biblischen Sprachgebrauch beziehen sich „rufen“ und „erwählen“ auf denselben Akt Gottes (s. z. B. Jes 41,9). Das Rufen Gottes setzt einen Prozess der Verwandlung in Gang und gibt den Gerufenen einen Auftrag. Sie sind gerufen wie auch Paulus selbst gerufen ist (s. 1,1). In der Auslegungsgeschichte von 1,26 ist oft versucht worden, das Wort klesis statisch zu deuten, so dass es den sozialen Status der Gemeindeglieder festschreibt. Wer arm und ungebildet ist, bleibt auch arm und ungebildet. 100Diese Deutung wird durch die Deutung desselben Wortes in 7,20 verursacht. In 7,20 gehe es um die Festschreibung des sozialen Status, an dem die Zugehörigkeit zum Leib Christi nichts ändert („Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat“, Einheitsübersetzung 1982). Diese Übersetzung von 7,20 wie die entsprechende Deutung von 1,26 dient dem politischen Inter esse an einer sozialen Status-quo-Theologie und trifft den biblischen und paulinischen Gedanken nicht (s. zu 7,17–24).
Paulus verwendet drei Begriffe für eine Skizze der sozialen Zusammensetzung der Gemeindein 1,26: nicht viele Weise, Mächtige und durch Geburt Privilegierte. Diese und ähnliche Begriffe (s. 1,27–28) und ihre Gegenbegriffe werden biblisch und außerbiblisch in unterschiedlichen Reihungen zur Beschreibung gesellschaftlicher Unterschiede benutzt. 101Als Gegenbegriffe benutzt Paulus: Ungebildete (mora), Schwache, von Geburt Benachteiligte, Verachtete, „Nichtse“ (1,27–28).
Die Begriffe sind ungenau und auch untereinander austauschbar. Hier in 1 Kor 1,26–31 wird der ökonomische Aspekt (arm – reich) nicht explizit erwähnt, er ist jedoch implizit präsent. Es ist möglich, dass mit diesen Reihungen von Gegensatzbegriffen der Gegensatz zwischen der kleinen Oberschicht, z. B. der städtischen Führungsschicht und der Mehrheit der Bevölkerung bezeichnet werden soll. Die Mehrheit lebt in Armut, hat kaum Zugang zu Bildung und ärztlicher Versorgung und wird von der Führungselite auch noch verachtet. 102Diese ungenauen Begriffe des Paulus sind also durchaus sozialgeschichtlich verifizierbar. Eine Mittelschicht gibt es nicht. Ob tatsächlich einige wenige aus der korinthischen Führungselite der Messiasgemeinde angehören, ist schwer zu beurteilen. 103
Читать дальше