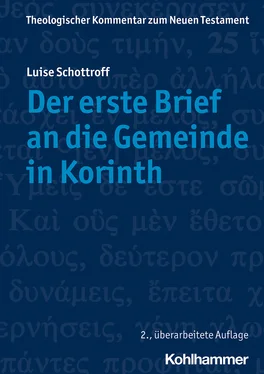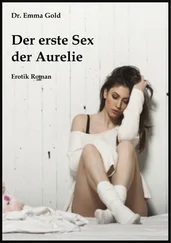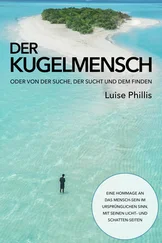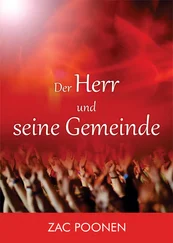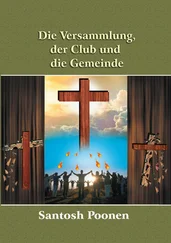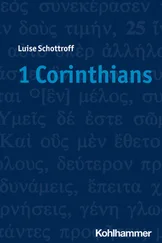Die Gemeinde ist Ort der Gegenwart Gottes. Der 1. Brief nach Korinth ist von solchen Glückssätzen durchzogen (s. auch Einführung zu 3,1-23).
In Jes 40,13 LXX bezieht sich das Wort kyrios auf Gott. In der paulinischen Antwort steht in einigen griechischen Handschriften: Wir haben Gedanken des Messias . Andere Handschriften schreiben: Gedanken des kyrios . Howard (1977, 80) zeigt überzeugend an zeitgenössischen Texten, dass Menschen wie Paulus das Tetragramm in griechischen Texten noch nicht wie spätere Versionen der Septuaginta durch kyrios ersetzten, sondern das Tetragramm in hebräischen Buchstaben in den griechischen Text einfügten. In Sätzen, die Schriftzitate dann kommentierten, wurden Bezugnahmen auf das Tetragramm mit kyrios vollzogen. Paulus kann hier also in seiner Antwort auf Jes 40,13 kyrios geschrieben haben und Gott (das Tetragramm des Zitates) damit aufgenommen haben. Im 2. Jahrhundert wurde zunehmend das Wort kyrios auf Christus gedeutet. Die Handschriften, die hier Christos statt kyrios schreiben, wollten mehr christologische Eindeutigkeit erreichen: „Wir haben Gedanken des Messias“ – als Antwort auf die Frage: „Wer hat die Gedanken der Ewigen erkannt?“. Es muss Hypothese bleiben, was Paulus anstelle des Tetragramms geschrieben hat. Er benutzt aber kyrios für Jesus / den Messias noch nicht in einem durch dieses Wort auf Gott verweisenden Sinne. 149Es ist wahrscheinlich, dass er in der Antwort (2,16b) auf Gott verweist. Bei der Interpretation des Paulus ist der nachpaulinische Prozess der Christologisierung, der hier sichtbar wird, zu berücksichtigen. Paulus versteht den Messias nicht als gottheitliche Gestalt.
3,1–23 In 3,1–23(und Kapitel 4) führt Paulus im Detail aus, wofür er in 1,10–2,16 die Grundlagen geschaffen hat: Die Zusammengehörigkeit mit dem Messias Jesus, der von Rom gekreuzigt und vom Gott Israels aufgeweckt wurde und nun in der Gemeinde lebendig ist, hat Konsequenzen für das Zusammenleben. Konkurrenzstrukturen und andere Machtkämpfe um Herrschaft in der Gemeinde zeichnen zwar die „Welt“ und ihre Weisheit, sie widersprechen aber dem Messias und der Erwählung der Erniedrigten durch Gott. Paulus versteht seinen Brief als väterliche Ermutigungs- und Erziehungsrede in diese Situation hinein. Mit 3,1–4 knüpft er an 1,10–18 an. Er kritisiert Machtkämpfe in der Gemeinde fundamental. Sein Hauptziel ist dabei, dass die Gemeinde den Reichtum Gottes, den der Leib Christi geschenkt bekommen hat, wahrnimmt und daraus die Kraft zur Gestaltung der Gerechtigkeit schöpft. Die großen Ermutigungen sind Herzstücke dieser väterlichen Erziehungsrede von 1,10–4,21: Sie finden sich in 1,30.31; 2,6–16; 3,16.21b–23. Sie führen 1,4–9 fort. Hier hatte er von seiner Dankbarkeit Gott gegenüber für ihren Reichtum berichtet und ein erstes Mal den begeisterten Ton angeschlagen, der sich in seinen Ermutigungssätzen durchhält.
In 3,5–11 spricht Paulus über sein Verhältnis zu Apollos, das in den Konkurrenzen eine Rolle spielt. Er benutzt dabei zwei Bildfelder: eines vom Gartenbau und eines vom Hausbau. In 3,12–17 zeigt sich dann, dass er das Gebäude, die Gemeinde, als Tempel und Wohnort Gottes versteht. Es geht hier um die große Verantwortung aller, die an dem Gebäude arbeiten. In 3,18–23 fasst Paulus seine bisherigen Gedanken zu den Konkurrenzen und zur Heiligkeit der Gemeinde zusammen.
1 Doch, ihr Geschwister, ich konnte euch nicht als Menschen anreden, die von der Geistkraft erfüllt sind. Ihr wart Kinder eurer Zeit, Säuglinge in Christus. 2 Muttermilch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Nahrung. Ihr wart noch nicht so weit und seid es auch jetzt noch nicht. 3 Denn ihr lebt noch gefangen in euren Begrenzungen. Wenn es bei euch Konkurrenzen und Streit gibt, seid ihr dann nicht Kinder eurer Zeit, die so leben, wie es in der Gesellschaft üblich ist? 4 Wenn einige sagen: Ich gehöre zur Paulusgruppe, andere, ich gehöre zur Apollosgruppe, benehmt ihr euch da nicht wie alle anderen?
3,1 Eigentlich sollten sie als Geistmenschen leben können: 3,1knüpft an 2,15 an, aber faktisch steht ihre Praxis im Widerspruch zu ihrer Beziehung zu Gott. Sie leben in ihrem Alltag so, als hätten sie keine messianische Befreiung erfahren: Sie passen sich an die Strukturen dieser Welt an (sarkinoi vgl. 3,3).
3,1.2 3,1.2benutzt Paulus ein Bild: Er hat die Gemeinde wie eine stillende Mutter oder Amme Milch trinken lassen, da sie wie Säuglinge waren, die feste Speise noch nicht vertragen; ja dieser Zustand hält sogar bis in die Gegenwart an. Dass es Stufen in der Erziehung gibt, die mit der Ernährung erst durch Milch, dann durch feste Kost verglichen werden, hat außerbiblische Parallelen. 150Ungewöhnlich ist jedoch vor diesem Hintergrund, dass Paulus dabei dieses Bild auf sich selbst bezieht 151und sich mit einer stillenden Mutter oder Amme vergleicht. Paulus bringt an den wenigen Stellen, an denen er sich in elterliche Beziehung zur Gemeinde setzt, wenn er sich Vater nennt, die Mutter auch ins Spiel (hier: 4,14–16). 152In einer Gesellschaft, in der Männlichkeit der Ideologie des Imperium dient und als Repräsentation von Herrschaft öffentlich dargestellt werden soll, ist seine Selbstdarstellung deutlich nicht-männlich (vgl. sein Verhältnis zur öffentlichen Rhetorik 2,1). Damit wird seine Arbeit als Erzieher der Gemeinde bewusst von Dominanzanspruch freigehalten. 153 Paulusmacht sich darüber hinaus als nicht-männlicher Mannangreifbar und lächerlich: Er vollzieht ein bewusstes „queering“ 154, d. h. er hält sich nicht an die gesellschaftlich verlangte Ordnung der Geschlechter- und Herrschaftsidentität. Milch und feste Speise beziehen sich auf die unterschiedliche Deutlichkeit der Kritik an Machtkämpfen, nicht auf zwei Versionen des Evangeliums, wie häufig diskutiert wird.
3,3.4 3,3.4sollten nicht als Polemik verstanden werden, sondern als Kritik, die darauf hinweist, was für Strukturen sich in Konkurrenzen und Streit erkennen lassen: die ahnungslose Anpassung an gesellschaftliche Machtkämpfe, die auf Unterdrückung anderer Menschen zielt. kata anthropon (vgl. den Gebrauch des Wortes anthropos in 1,25; 2,5 und 3,4) „wie es unter Menschen üblich ist“, wertet nicht Menschsein als solches ab. Vielmehr geht es um gesellschaftliche Strukturen, die zerstören statt aufzubauen: Menschsein ohne Gott. Überzeugungskraft gewinnt sein aufklärendes Argument daraus, dass er voraussetzen kann: Eben dies wollen die Angeredeten ja gerade nicht. Sie wollen nach Gottes Willen leben.
3,4 nimmt auf 1,11–13 Bezug. Hier äußert er deutliche Kritik; dies ist die feste Speise (3,2), die Paulus bisher nur weniger massiv vertrat.
5 Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Wir beide haben dafür gearbeitet, dass euer Gottvertrauen wächst, beide so wie wir von der Ewigen beauftragt wurden. 6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, doch Gott hat das Wachstum geschenkt. 7 Gott schenkt das Wachstum, deshalb ist es nicht wichtig, wer pflanzt oder wer gießt. 8 Wer pflanzt oder wer gießt, tut dies in Gemeinschaft. Beide werden jedoch eigenen Lohn empfangen entsprechend ihrer Arbeit.
9 Wir arbeiten gemeinsam mit Gott. Gottes Acker, Gottes Bauwerk, das seid ihr. 10 Weil mir von Gott die Gnade geschenkt wurde, habe ich wie ein kluger Baumeister am Fundament gearbeitet. Andere bauen weiter. Wer weiterbaut, soll sich Gedanken machen, wie es weitergeht. 11 Ein anderes Fundament kann niemand legen als das, das schon von Gott gelegt ist. Das Fundament ist Jesus, der Messias.
3,5 3,5In den Streitigkeiten sind nach Paulus’ Vorstellung er selbst und Apollos gegeneinander ausgespielt worden. Deshalb stellt Paulus nun ausführlich sein Verhältnis zu Apollos und beider Bedeutung für die Gemeinde in Korinth dar (bis 4,6). Seine Absicht dabei ist deutlich zu machen, dass sie nicht konkurriert haben und auch nicht dazu taugen, Konkurrenz unter Mitgliedern der Gemeinde zu begründen. Das sagt er deutlich gegen Ende dieser Darlegung zum Thema Paulus und Apollos (in 4,6). Seine Darlegung enthält grundlegende Aussagen zu seiner theologischen Vorstellung von Gemeinde und seiner Beziehung zu ihr.
Читать дальше