»Oxford, Sir«, fiel sie mir ins Wort. »Und so vertraut mir auch all die Theorien über historische Integration sind – wenn der Kern der Überlieferung in verschiedenen Kulturen gleich ist, aber die darum entstandene Legende oder Geschichte recht unterschiedlich, deutet das auf eine gewisse Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit …«
Ich zog wenig beeindruckt die Augenbraue hoch. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schreiben Sie das auf und reichen Sie es bei der Historical Review oder dem Asian History Qarterly ein. Ich bin sicher, man wird Sie auf die eine oder andere Weise häufig zitieren.«
Man musste ihr zugutehalten, dass sie nicht beleidigt war. Aber es sah auch nicht aus, als würde sie aufgeben. »Professor …«
Ich stand auf. »Auf Wiedersehen, Miss Jervois.«
»Warten Sie …« Sie rutschte auf dem Stuhl nach vorn.
»Danke für Ihr Interesse an uns.«
»Der Vajra existiert, Professor. Er ist mehr als eine Legende.«
»Dann viel Glück beim Suchen.«
»Ich habe ihn bereits gefunden.«
Ich reagierte auf diese Aussage auf die einzig mögliche Weise. Ich lachte.
Das Leben hatte mich in seiner unendlichen Weisheit gelehrt, herzlich, aber nie zu lange zu lachen. Ich setzte mich und Maya Jervois' beleidigtes Schweigen füllte den Raum, während ich meine Gedanken sammelte.
Als Schüler war mir beigebracht worden, nie die Dualität aller Dinge zu ignorieren – denn darin lag oft die Lösung verwirrender Probleme. Weniger abstrakt formuliert bedeutete es, dass alle Dinge eine Grenze hatten; zu jeder Form gab es ein Gegenstück. Der Tod war die Grenze des Lebens; die beiden waren untrennbar verbunden. Die Wissenschaft sah das ebenso.
Alter und Verfall von Lebewesen waren dadurch bestimmt, dass Zellen nur eine bestimmte Zahl von Zellteilungen vollziehen konnten, bevor die Integrität ihrer Chromosomen in Mitleidenschaft gezogen wurde, eine Konstante, die als Hayflick-Grenze bezeichnet wurde. Embryonale Stammzellen – die Art Zellen, die keine festgelegte Funktion hatten, sondern über die Fähigkeit verfügten, sich zu bestimmten Formen von Gewebe zu entwickeln, etwa Muskeln oder Knochen – konnten sich jedoch theoretisch unendlich erneuern. Diese Möglichkeit erklärte die »Unsterblichkeit« mancher Amöben oder sogar die von Quallen, aber sie traf nicht auf irgendetwas zu, das höher auf der evolutionären Leiter stand. Und das mit gutem Grund. Kreaturen, die völlig aus derlei biologisch »unsterblichem« Material bestanden, konnten nicht mehr als Klumpen von Materie oder Tumoren sein, die nur zu einem in der Lage waren: konstantem und endlosen Wachstum. Mehrzellige Lebewesen – Menschen zum Beispiel – waren viel komplexer, und der Preis, den sie dafür bezahlten, war die unabwendbare Sterblichkeit. An dieser Stelle traf die Macht der Genetik auf einen Stolperstein.
Durch alle Zeitalter, in denen Physik, Biologie und Chemie noch keine Lösungen anbieten konnten, hatten sich selbst die größten wissenschaftlichen Geister der Alchemie zugewandt, inklusive eines der größten Denker der Wissenschaft, den wir kennen: Sir Isaac Newton. Als Newton 1727 starb, waren aus seinem Nachlass mehr als 300 Dokumente für »ungeeignet zur Veröffentlichung« erklärt worden. Diese wurden seiner Nichte Catherine überlassen, der Burggräfin von Lymington aus dem Grafenhaus von Portsmouth. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Portsmouth-Sammlung, wie sie dann genannt wurde, erblickte das Licht der Öffentlichkeit erst 1946, 200 Jahre später, und sorgte dafür, dass die Hölle losbrach. Mehr als ein Drittel der Sammlung, so stellte sich heraus, war dem Studium der Alchemie gewidmet und enthielt genauso viele Bezüge auf Drachen, Dreizacke und Löwen wie auf normale chemische Prozesse wie Destillation und Kalzinierung.
Die Portsmouth-Dokumente sorgten für ein Wiedererwachen des wissenschaftlichen Interesses an diesem Thema, und weil Newtons Beteiligung dem Ganzen eine gewisse Glaubwürdigkeit verlieh, wurde etwas offensichtlich, was Historiker lange vermutet hatten – dass die Alchemie eine sehr alte und etablierte Disziplin war, die sich vom mittelalterlichen Europa über das antike Griechenland und Arabien bis nach Indien zurückverfolgen ließ. Dennoch waren alle Versuche, die Ergebnisse anzuwenden, in Newtons Zeit und auch danach vergeblich gewesen.
Zu denselben Schlüssen war auch ich selbst gekommen, da ich mich freiwillig mit den kratzigen Perücken und den furchtbaren Gehröcken, die damals in Mode waren, ausstaffiert und eine Mitgliedschaft in der Royal Society in London erworben hatte. Dort freundete ich mich mit dem gefeierten Gelehrten an, um seine Arbeit aus der Nähe verfolgen zu können. Nachdem dieser Versuch keine Ergebnisse brachte, hatte ich recht skrupellos sein Dahinscheiden genutzt, um Catherine kennenzulernen – eine Frau, die ebenso wegen ihres Intellekts wie aufgrund ihres Aussehens unwiderstehlich war – und hatte damit Zugang zu den Portsmouth-Papieren bekommen. Es war nicht das erste Mal, dass ich meine politischen und sonstigen Fähigkeiten eingesetzt hatte, um nach Antworten zu suchen.
Es war ebenso wenig das letzte Mal gewesen, denn was ich in diesen Papieren fand, hatte mich enttäuscht zurückgelassen. Trotz all seiner Skizzen von Drachen und Pipetten hatte Newton nur wenig mehr getan als alle anderen vor ihm – er hatte darauf bestanden, dass Transmutation möglich sei, aber nichts in seinen Aufzeichnungen hatte irgendeinen Anhaltspunkt geliefert, wie man diese herbeiführen konnte. Was die Alchemie betraf, hatte selbst Isaac Newton die Menschheit kein bisschen weiser gemacht. Durch diese Überlegungen ernüchtert, wandte ich mich Manohar zu und sah ihn an.
Er ergriff die Gelegenheit, um die Stille zu unterbrechen. »Professor, kann ich Sie kurz unter vier Augen sprechen?« Er murmelte unserer Klientin ein paar höfliche Entschuldigungen zu und führte mich aus dem Zimmer in die relative Privatsphäre einer Ecke des äußeren Büros.
Bevor ich ihn für das, was er getan hatte, tadeln konnte, sagte er: »Es gibt hier zwei Möglichkeiten, Professor, und keine von beiden lässt sich leicht von der Hand weisen. Entweder ist sie mit dieser lächerlichen Geschichte zu Ihnen gekommen, weil sie mehr über Sie weiß, als sie wissen sollte, so schätze ich übrigens die Situation ein, oder …«
»Oder?«
»Oder sie sagt die Wahrheit.«
Für diese Aussage und alles, was davor geschehen war, hatte er es nicht anders verdient: »Sie haben wohl völlig den Verstand verloren, Manohar! Wie können Sie sie ernstnehmen? Sie haben Ihre und meine Zeit verschwendet.«
»Aber …«
»So etwas wie einen Stein der Weisen gibt es nicht. Er existiert nicht. Sagen Sie mir nicht, Sie sind dumm genug, das zu glauben …«
»Boss …«
»Und wenn sie so dämlich ist, sich keine überzeugendere Geschichte einfallen zu lassen, um anderweitige Motive zu verbergen, dann kann es mir völlig egal sein, was sie über mich weiß oder vermutet. Darüber muss ich mir wohl kaum Sorgen machen!«
Man musste es Manohar lassen, er stand seinen Mann. »Sind Sie sicher, Boss? Ich meine, über diesen Vajra? Sind Sie absolut sicher? Ich meine … wir wissen, was wir wissen …«
Manohar hatte es nie leiden können, unser Geheimnis laut auszusprechen. Ich hatte das immer für ihn tun müssen. Dieses Mal jedoch war ich verwundert, dass ich es überhaupt tun musste. Ich wurde unruhig, überlegte gar, ob ich nicht einfach abwinken und aus dem Büro stürmen sollte, verwarf die Idee jedoch wieder. Manohar war ein intelligenter Mann und betrachtete mich als seinen Mentor. Trotz meines unausgeführten Planes, zu verschwinden, ohne ihm etwas zu sagen (vielleicht auch gerade deswegen), hatte ich das Gefühl, ihm einige Antworten zu schulden, selbst wenn das bedeutete, ihm mehr zu offenbaren, als ich eigentlich wollte.
Читать дальше


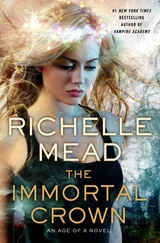



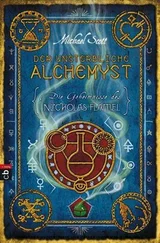

![Линси Сэндс - Meant to Be Immortal [calibre]](/books/384309/linsi-sends-meant-to-be-immortal-calibre-thumb.webp)



