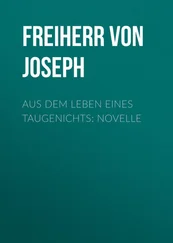Literarischer Bezug zu GoetheIch singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.
Doch darf ich bitten, bitt ich eins:
Lass mir den besten Becher Weins
In purem Golde reichen.4
Wein statt Geld – das heißt nichts anderes, als dass die Die Umwertung der WerteBewertungsskala, nach der der Müller seinen Sohn »Taugenichts« nannte, umgedreht wird: Ganz oben steht für den Erzähler jetzt der wandernde und singende junge Mann, der in die freie Welt zieht und die zu Hause lässt, die zur »Arbeit hinausziehen« und »graben und pflügen« (S. 5).
Der neue Taugenichts lässt sich nicht mit den Maßstäben der Arbeits- und Erwerbswelt messen. Die Tüchtigkeit der Künstler, so lautet die These, ist anderer Art als die der Bauern, Arbeiter und Beamten. Folgerichtig muss daher die Bezeichnung »Taugenichts« für einen Vertreter dieses Standes und dieser Lebenskonzeption als völlig unangemessen zurückgewiesen werden. Nur voller Ironie übernimmt der selbstbewusste Künstler das Wort zur Selbstcharakterisierung und erwartet von jedem Verständigen, dass er in Gedanken ein »angeblich« davorsetzt. Neuer Maßstab = Künstler, Sänger, DichterNach dieser Umwertung der Werte nimmt der einst ausgeschimpfte Taugenichts »die richtige Position« ein, während der Vater »auf der falschen Position«5 verharrt. Ganz oben stehen jetzt die Künstler, Sänger, Dichter; ganz unten sind die, »die zu Hause liegen« und nur von »Kinderwiegen / Von Sorgen, Last und Not« (S. 6) wissen.
Eine gewisse Verwandtschaft erkennt der Ich-Erzähler zwischen sich und den »Prager Lebenskonzeption: Student-SeinStudenten« (S. 83), die – wie er – »in dem großen Bilderbuche« studieren, »das der liebe Gott uns draußen aufgeschlagen hat« (S. 84). Auch sie ziehen musizierend durch die Welt und warten von Tag zu Tag, dass ihnen »ein besonderes Glück« (S. 84) begegne. Doch ist für sie das Studentenleben nur ein Zwischenstadium – »eine große Vakanz […] zwischen der engen düstern Schule und der ernsten Amtsarbeit« (S. 90). Für den Taugenichts ist ›Student-Sein‹ eine Lebenskonzeption, die nicht an äußere Bedingungen geknüpft, sondern eine Sache der inneren Einstellung ist.
Melancholische SeiteAllerdings muss derjenige, der nach dieser Konzeption lebt, durchaus Entbehrungen auf sich nehmen. Auch das Leben des Taugenichts ist nicht durchgehend »wie ein ewiger Sonntag« (S. 5). Er erlebt Tiefpunkte, Herausforderungen und Krisen, fühlt sich ab und zu einsam und hat zwischendurch das Empfinden, »als wäre [er] überall eben zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf [ihn] gerechnet« (S. 22). Wenn er dann am Ende seine geliebte schöne Dame findet und heiratet, so weiß man immer noch nicht, wie sein Leben weitergehen wird und ob er sich die Jugendlichkeit, die Offenheit für die Wunder der Welt und den Optimismus wird bewahren können oder ob auch er zum sogenannten Philister wird.
Aurelie – die »liebe schöne Frau«.Die zweite Hauptfigur der Novelle ist eine junge Frau, deren Namen der Leser, aber auch der Titelheld und der Erzähler erst spät, fast nebenher und unter verwirrenden Umständen kennenlernt. Sie heißt »Aurelie« (S. 55) und wird als Die Begleiterin der SchlossherrinBegleiterin der Schlossherrin eingeführt, mit der sie von einer Reise heimkehrt. Diese Aurelie ist, wie der aufmerksame und im Lesen von Romanen geübte Leser direkt am Anfang merkt, dem sogenannten Taugenichts auf besondere Weise zugeordnet. Die Beziehungsgeschichte zwischen Aurelie und dem Taugenichts beginnt mit der ersten Begegnung der beiden Figuren auf der Landstraße und erreicht ihre Vollendung mit der in Aussicht gestellten »Trauung« (S. 101) auf der letzten Seite des Erzähltextes.
Die erste BegegnungEben erst hat der von zu Hause Losgezogene sein Glaubenslied Wem Gott will rechte Gunst erweisen (S. 6) gesungen, da erscheint neben ihm »ein köstlicher Reisewagen« und »zwei vornehme Damen« (S. 6) stecken die Köpfe hinaus. Sie haben offensichtlich den Wanderer singen gehört und sind an ihm oder seinem Lied interessiert. Die eine dieser Damen beschreibt der Erzähler als »besonders schön und jünger als die andere« (S. 6) – ein erstes Indiz für die Liebe des Taugenichts!
Die Kutsche hält und die ältere der Damen beginnt ein Gespräch mit dem offensichtlich verdutzten Wandersmann. Die Das adlige BenehmenDamen beraten sich auf Französisch, also in der gehobenen Sprache des europäischen Adels, die für den Taugenichts unverständlich ist. In Frage scheint zu stehen, ob es mit den Regeln der Gesellschaft in Einklang zu bringen ist, dem singenden Wanderer einen Platz in oder auf der Kutsche anzubieten. Überraschenderweise schüttelt die jüngere der beiden Damen »einige Mal mit dem Kopfe« (S. 6). Die »andere lachte aber […] und rief mir endlich zu: ›Spring Er nur hinten mit auf‹« (S. 6).
Wortführerin und Entscheidungsträgerin ist die ältere der beiden Damen, sie kann sich auch über Konventionen hinwegsetzen. In den besonderen Blick des Taugenichts gerät jedoch die Jung, schön, pflichtbewusstandere, die »besonders schön und jünger« (S. 6) ist. Dabei ist ihr deutlich anzumerken, dass auch sie Sympathie für den jungen Wanderer und seine Lieder hat. Sie handelt wohl eher pflichtgemäß, wenn sie davor warnt, den Taugenichts mit auf die Reise nach Wien zu nehmen. Bald wird man merken, dass sie diesem Taugenichts sehr zugetan ist. Die Beziehungsgeschichte beginnt.
Der Leser wird erst später erfahren, dass die schöne junge Die Herkunft und die StellungFrau, die zunächst Bedenken hat, den Taugenichts zur Mitreise einzuladen, keineswegs adlig ist. Sie wohnt zwar im Schloss, ist aber eine »Waise« (S. 100) und lediglich die Nichte des Portiers. Sie gehört nur als Gesellschafterin und ständige Begleiterin der Gräfin zur Hofgesellschaft. Doch sie spricht französisch, die Sprache des Hofes, und weiß, wie man sich am Hof zu kleiden und zu bewegen hat.
Für den einst als Taugenichts beschimpften jungen Mann, der dann als Die umworbene DameSänger und Wanderer aufgefallen ist und nun eine Stelle als Gärtner im Schlosspark erhält, ist die jüngere der beiden Damen bald »die liebe schöne Frau«, die er heimlich verehrt, die er aus der Ferne beobachtet und der er zuhört, wenn sie »so wundersam über den Garten hinaus« (S. 11) singt, von der Gitarre begleitet. Der kenntnisreiche Leser durchschaut, dass hier jene Situation nachgestellt wird, in der der höfische Ritter der von ihm verehrten Dame begegnet. Auch der minnende Taugenichts-Gärtner singt alle »Lieder, die [er] nur wusste, bis alle Nachtigallen draußen« (S. 10) erwachen. Er verharrt in stiller Verehrung.
Zu den Hofritualen gehören unter anderem musikalische Darbietungen, Kahnfahrten – und Jagdpartien. An einer solchen Jagdpartie nimmt auch »die schöne gnädige »[E]in Engelsbild«Frau« teil – »in einem grünen Jagdhabit und mit nickenden Federn auf dem Hute« (S. 17). Das Bild beeindruckt den Gärtner: »Ich war wie betrunken vor Angst, Herzklopfen und großer Freude« (S. 18). Die Begegnung hat Folgen: »Seit diesem Abend hatte ich weder Ruh noch Rast mehr« (S. 18). Ganz offensichtlich ist der Gärtner in Liebe entflammt. Die junge Frau, die auf ihn »wie ein Engelsbild« (S. 9) wirkt, weckt Liebesgefühle, die ihm »durch Leib und Seele« (S. 13) gingen. Und als er sich die Aussichtslosigkeit seines Begehrens vor Augen hält, flieht er nach Italien.
Die jungfräuliche IkoneDie vermeintlich »schöne gnädige Frau« (S. 17) ist für den seiner Lieder wegen in den Hofkreis aufgenommenen Müllerssohn einerseits ein aus der Ferne verehrtes Idol – in der Art einer jungfräulichen Ikone mit einer »Lilie« (S. 12) in der Hand, die er mit der Erscheinung der Gottesmutter Maria vergleicht; andererseits ist sie auch eine begehrte junge Frau, die beim Taugenichts Herzklopfen auslöst. Auf der anderen Seite hält auch die »schöne junge Frau« die »Augen niedergeschlagen« (S. 14), wenn sie besungen wird. Längst ist das Gesellschaftsspiel, LiebesspielGesellschaftsspiel zum Liebesspiel geworden, das nicht von Konventionen bestimmt wird, sondern von den natürlichen Regungen zweier junger Menschen, die füreinander bestimmt zu sein scheinen.
Читать дальше