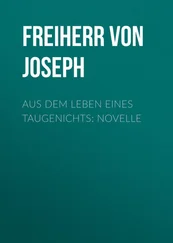Allerdings vergisst er über diese Veränderungen »die allerschönste Frau keineswegs« (S. 16): Das Amt als Zolleinnehmer lässt ihm Zeit genug, einen Der BlumengartenBlumengarten anzulegen und jeden Tag einen Strauß für die Verehrte zu binden, der eine Zeit lang heimlich abgeholt wird, dann aber liegen bleibt. Als die Kammerjungfer dem still Verliebten eines Tages den Auftrag übermittelt, für »die gnädige Frau« anlässlich eines Maskenballs Blumen bereitzustellen, ist er »verblüfft vor Freude« (S. 20), weiß er doch Missverständnissenicht, dass der Auftrag tatsächlich von der Gräfin und keineswegs von seiner Angebeteten kommt. Diese sieht er später neben dem jungen Schlossherrn auf dem Balkon, wo man die beiden hochleben lässt. Der Taugenichts kann wiederum nicht wissen, dass »die schöne junge […] Frau« (S. 24) Geburtstag hat und deshalb beglückwünscht wird, dass sie aber nicht – wie von ihm vermutet – mit dem Herrn an ihrer Seite verheiratet ist.
Grenzenlos enttäuscht, holt der Taugenichts die Geige von der Wand und Emotionale Abreise nach Italienzieht »gen Italien hinunter« (S. 27). Dabei ist er »traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich, wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt« (S. 26); er singt die vierte Strophe jenes Lieds, das er sang, als er von zu Hause fortging, wo es heißt: »Den lieben Gott lass ich nur walten« (S. 26).
Da er des Nach ItalienWegs nicht sicher ist, versucht er sich durchzufragen. Dabei trifft er auf einen unwirschen Bauern, aber auch auf einen Schäfer in friedlicher Idylle und eine lebhafte Dorfgemeinschaft: Als er in einem Dorf zum Tanz aufspielt, macht ihm die Tochter eines wohlhabenden Gastwirts eindeutige Avancen. Ehe er jedoch eine eigene Entscheidung darüber fällen kann, ob er bei dem Mädchen im Dorf bleiben möchte, wird er von zwei Reitern entführt, die ihn für ortskundig halten und zwingen wollen, ihnen den »Weg nach B.« (S. 35 f.) zu zeigen. Unterwegs erkennen die beiden Reiter, dass der Überwältigte der »Einnehmer vom Schloss« (S. 37) ist, und bieten ihm einen Posten als Diener an. Der Taugenichts seinerseits merkt nicht, dass er in die Flucht zweier sich verboten Liebender verwickelt wird, die der Gräfin vom Schloss in Wien zu entkommen versuchen; er durchschaut nicht einmal, dass der angebliche »Maler Leonhard« kein Maler und der »Maler Guido« nicht einmal ein Mann ist (S. 38).
Eher zufällig treffen die drei Reisegefährten auf das Dorf B., das anvisierte Ziel der beiden angeblichen Maler.
In B. steht für sie »ein prächtiger Wagen mit vier Postpferden« (S. 40) bereit. Der Taugenichts wird veranlasst, seine angeblich ausgewachsenen Kleider gegen eine vornehme Montur zu Eine neue Rollewechseln und zu dritt geht es »frisch nach Italien hinein« (S. 40). Während eines Aufenthalts in einem Rasthaus ziehen sich die »Maler« zurück, um Briefe zu schreiben; der Taugenichts trifft beim Abendessen in der Gaststube auf ein »Männlein« (S. 42), das ihn nach seinen Reiseplänen ausfragt. Der Taugenichts flieht vor dem unangenehmen Gefährten nach draußen, bemerkt dort zwar manchmal »eine lange dunkle Gestalt« (S. 43), denkt sich aber nicht viel dabei, und schläft auf einer Bank vor dem Wirtshaus ein. Als er bei Tagesdämmerung wach wird, muss er feststellen, dass die beiden »Maler« Die plötzliche Abreise der »Maler«verschwunden sind. Sie haben ihm jedoch einen vollen Geldbeutel und den Postwagen zurückgelassen, so dass er die Fahrt »in die weite Welt hinein« (S. 45) fortsetzen kann.
Der Weg ist offensichtlich vorbestimmt und festgelegt. Er führt durch unwirtliches Gebiet; der Kutscher ist unruhig und fühlt sich verfolgt und plötzlich reitet das »buckliche Männlein« (S. 47) vom Vorabend an der Kutsche vorbei. Endlich scheint das Ziel, »ein großes altes Erneut auf einem SchlossSchloss« (S. 47) im Gebirge, erreicht, in dem der Taugenichts herrschaftlich empfangen wird. Es gefällt ihm alles »recht wohl« (S. 49); er merkt allerdings nicht, dass er in eine falsche Rolle gewiesen wurde. Im Schloss hält man ihn für eine als Mann verkleidete junge Dame; der Leser darf vermuten, dass man eigentlich auf die beiden »Maler« eingerichtet ist, die selbst unter falschem Namen reisen.
Das Schloss, so erfährt der Taugenichts, gehört »einem reichen Grafen« (S. 53). Das angenehme Leben, das dem Taugenichts im Schloss bereitet wird, beginnt ihm langweilig zu werden, auch wenn er das Verhalten der Bewohner seltsam findet. Da wird ihm eines Tages ein VerwechslungenBrief vom Postillon überbracht, der mit »Aurelie« (S. 55) unterzeichnet ist. Darin steht, dass »alles wieder gut« und zu Hause alles öde sei, »seit Sie von uns fort sind« (S. 55). Für den Taugenichts ist klar, dass der Brief an ihn gerichtet und von der »schönen jungen Frau« geschrieben ist. Überglücklich will er sich sofort auf den Weg machen.
Tatsächlich ist der Brief aber für die gräfliche Tochter Flora bestimmt, die man als Maler Guido verkleidet im Schloss glaubt. Dieser scheinen die Verfolger, wie etwa das »buckliche Männlein«, auf die Spur gekommen zu sein. Nur mit Mühe kann sich der Die Flucht des TaugenichtsTaugenichts, der von allen – von den Verfolgern und von den Beschützern im Schloss – für die flüchtige Flora gehalten wird, aus dem verschlossenen Zimmer und aus der versperrten Schlossanlage nach draußen retten, um das Weite zu suchen. Auch der Student, der ihm bei der Flucht hilft, täuscht sich, als er dem Taugenichts ein Liebesgeständnis macht, da er ihn für eine verkleidete Frau hält. Draußen merkt der Taugenichts, dass man vom Schloss aus die Verfolgung aufnimmt; er flieht und läuft »in das Tal und die Nacht hinaus« (S. 60).
Bald darauf kommt er durch »eine große, einsame Heide« (S. 61) und erreicht etwas später In RomRom. Er hat kaum das Stadttor passiert, da hört er in einem Garten eine Gitarre spielen und eine Stimme jenes »welsche Liedchen« (S. 62) singen, das »die schöne gnädige Frau« (S. 68) so oft zu Hause sang. Er übersteigt die Gartenmauer, doch die Sängerin entflieht unerkannt in ein Haus; der Taugenichts entschließt sich zu warten, schläft dann aber auf der »Schwelle vor der Haustür« (S. 63) ein. Am nächsten Morgen trifft er auf einen Landsmann, einen Maler, der ihn zunächst mit sich nach Hause nimmt und dann bestätigt, dass sich »eine Der Taugenichts wird gesuchtGräfin aus Deutschland« hier in Rom nach zwei »Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Geige« (S. 67) erkundigt habe. Sofort glaubt der Taugenichts, dass er selbst der gesuchte Musikant sei und dass seine geliebte und verehrte Frau in unmittelbarer Nähe sein müsse.
»Wie verzaubert« (S. 68) läuft der Taugenichts orientierungslos durch Rom und ist erfreut, als er den malenden Landsmann zufällig wiedertrifft, der ihn zu einem Spaziergang vor die Stadt einlädt. Sie hören einer Abendmusik zu, die bald von einem streitenden Paar gestört wird. Hoch Erneute Verwechslungenerstaunt ist der Taugenichts, als er in dem streitsüchtigen Mädchen die Kammerjungfer seiner Herrschaft erkennt, die ihm ganz schnell einen Zettel zusteckt, er möge um »[e]lf Uhr an der kleinen Türe« sein; »die schöne junge Gräfin« (S. 74) erwarte ihn. Als er etwas zu früh an der bezeichneten Gartenpforte ist, spielt ihm die Phantasie wieder einen Streich: Er hält die mit einem Mantel bekleidete Kammerjungfer für einen Mörder und löst einen Tumult aus. Die schöne Gräfin, zu der er geladen ist, stellt sich als »eine etwas große korpulente, mächtige Dame« (S. 79) dar, die an einem Verzicht auf LiebesabenteuerLiebesabenteuer mit ihm interessiert ist und deshalb den Zettel schickte. Und diejenigen, die er sucht – so erfährt er –, sind schon lange wieder in Deutschland. Sofort beschließt er, »dem falschen Italien […] den Rücken zu kehren« (S. 80).
Читать дальше