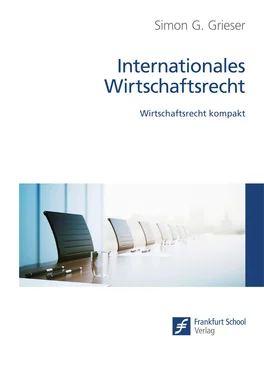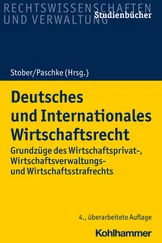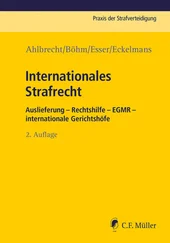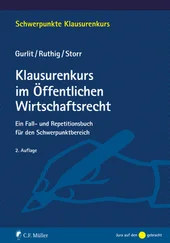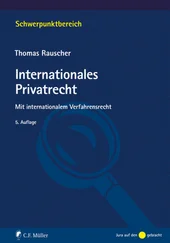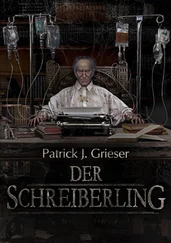Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreiseverträgen i.S.d. Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13.06.1990 über Pauschalreisen;
Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen oder die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum Gegenstand haben, mit Ausnahme der Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien i.S.d. Richtlinie 94/47/EG;
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument sowie Rechte und Pflichten, durch die die Bedingungen für die Ausgabe oder das öffentliche Angebot und öffentliche Übernahmeangebote bezüglich übertragbarer Wertpapiere und die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es sich dabei nicht um die Erbringung von Finanzdienstleistungen handelt.
Die Regelung des Abs. 4 Buchst. a ROM-I-VO umfasst z.B. Dienstleistungen eines Fremdenführers oder Skilehrers, [77]der die Leistung komplett in dem anderen Land erbringt, aber auch örtliche Bank- und Brokerdienstleistungen. [78]
Daneben sind für Verbraucherverträge insbesondere die Regelungen in Art. 3 Abs. 3 und 4 [79]und Art. 9 ROM-I-VO [80]sowie Art. 46b EGBGB [81]zu beachten.
1.7.3 Außervertragliches Schuldrecht
1.7.3.1 Allgemein
Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen ist die ROM-II-VO anwendbar. Darunter fallen nach der Legaldefinition in Art. 2 Abs. 1 ROM-II-VO Ansprüche aus Deliktsrecht (z.B. § 823 BGB), aber auch aus gesetzlichen Schuldverhältnissen wie der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 667 ff. BGB) oder aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen (c.i.c., §§ 311, 280 BGB) sowie aus Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB). Nach Art. 2 Abs. 2 und 3 ROM-II-VO fallen darunter auch künftige Schuldverhältnisse oder Schadensereignisse, deren Entstehung wahrscheinlich ist. Darüber hinaus ist die ROM-II-VO nach herrschender Meinung [82]auch auf die Regelungen des EBV nach §§ 989 ff. BGB sowie Ansprüche aus Vertrag zugunsten Dritter anwendbar, da für diese Art. 43 EGBGB nicht gilt. Auch bei der ROM-II-VO handelt es sich um universell anwendbares Recht (Art. 3 ROM-II-VO).
Allgemeine Kollisionsnorm für unerlaubte Handlungen ist Art. 4 ROM-II-VO. Danach ist grundsätzlich für die Bestimmung des anzuwendenden Rechts der Schadensort maßgeblich, also der Erfolgsort der unerlaubten Handlung (und nicht der Handlungsort wie in Art. 40 EGBGB). [83]Etwas anderes gilt jedoch nach Art. 4 Abs. 2 ROM-II-VO, wenn beide Parteien aus demselben Staat stammen. In diesem Fall ist allein das Recht des Herkunftsstaates der Parteien maßgeblich. Art. 4 Abs. 3 ROM-II-VO wird wegen seines Ausnahmecharakters auch als Ausweichklausel bezeichnet. [84]Dabei meint „offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen Staat“ insbesondere den Fall, dass ein Vertrag zwischen den Parteien besteht. [85]
Zu beachten ist jedoch, dass eine Reihe von Tatbeständen, die den Begriff der unerlaubten Handlung erfüllen, nicht nach Art. 4 ROM-II-VO anzuknüpfen sind, weil sie nach Art. 1 ROM-II-VO bereits vom Anwendungsbereich der Rom-II-VO ausgeschlossen sind. Das gilt zum einen für die deliktischen Rechtsbeziehungen, also Schädigungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte nach Art. 1 Abs. 1 S. 2 ROM-II-VO und zum anderen für solche, die unter die Bereichsausnahme des Art. 1 Abs. 2 ROM-II-VO fallen. Hinsichtlich der Bereichsausnahmen des Art. 1 Abs. 2 ROM-II-VO kommt es nicht darauf an, ob ein dort genannter Tatbestand als außervertragliches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung zu qualifizieren ist oder nicht. [86]Nach Art. 14 ROM-II-VO ist außerdem eine inter partes wirkende Rechtswahl möglich.
Das Recht der unerlaubten Handlungen ist außerdem in den Art. 40 bis 43 EGBGB geregelt. Die Regelungen gleichen in vielen Punkten denen des Art. 4 ROM-II-VO, sind jedoch nicht identisch. [87]Vorrangig ist hinsichtlich des anzuwenden Rechts danach zu fragen, ob eine – allerdings nur inter partes wirkende (Art. 40 S. 2 EGBGB) – Rechtswahl der Parteien nach Art. 42 S. 1 EGBGB erfolgt ist. Erst wenn dies nicht der Fall ist, ist auf die Regelungen der Art. 40, 41 EGBGB abzustellen. Nach dem vorrangig zu prüfenden Art. 40 Abs. 2 EGBGB ist grundsätzlich das Recht des Staates maßgeblich, in welchen der Ersatzpflichtige als auch der Verletzte seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. Sitz (Hauptverwaltung) haben.
Im Übrigen ist auf die Regelung des Art. 40 Abs. 1 EGBGB abzustellen, wonach das Statut des Handlungsortes oder – nach Wahl des Verletzten – das Recht des Staates in dem der Erfolg eingetreten ist, maßgeblich ist. Dabei ist zu beachten, dass die objektiven Anknüpfungspunkte des Art. 40 Abs. 1 EGBGB unter dem Vorbehalt einer „wesentlich engeren Verbindung“ nach Art. 41 EGBGB stehen.
1.7.3.3 Bereicherungsrecht
Das anzuwendende Bereicherungsrecht richtet sich nach Art. 10 ROM-II-VO. In Abs. 1 befindet sich eine vertragsakzessorische Anknüpfung. Für den Fall, dass eine Bestimmung des anzuwendenden Rechts nicht möglich ist, regelt Abs. 2, dass das Recht des Staates Anwendung finden soll, in dem beide Parteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Ist auch danach eine Bestimmung des anzuwendenden Rechts nicht möglich, so bestimmt Abs. 3 den Handlungsort als maßgeblichen Anknüpfungspunkt. In Abs. 4 befindet sich eine Ausweichklausel.
Art. 11 ROM-II-VO, welcher die Geschäftsführung ohne Auftrag regelt, entspricht im Aufbau und hinsichtlich der Prinzipien Art. 10 ROM-II-VO. Die Culpa in Contrahendo (c.i.c., vorvertragliche Schuldverhältnisse) wird in Art. 12 ROM-II-VO geregelt.
Eine Sondervorschrift für Produkthaftung findet sich in Art. 5 ROM-II-VO, nach welcher grundsätzlich der Aufenthaltsort des Verbrauchers maßgeblich ist, ansonsten ebenfalls Handlungsort oder Erfolgsort.
Geht es um Umweltschädigungen statuiert Art. 7 HS. 2 ROM-II-VO ein dahingehendes Wahlrecht des Geschädigten, dass – in Abweichung von der grundsätzlichen Verweisung auf die allgemeine Kollisionsregelung des Art. 4 ROM-II-VO im 1. HS – dieser seinen Anspruch auch auf das Recht des Handlungsortes stützen kann. [88]
Das Sachenrecht ist in Art. 43 bis 46 EGBGB geregelt. Für alle sachenrechtlichen Tatbestände gilt nach Art. 43 Abs. 1 EGBGB das Lageortsrecht ( lex rei sitae ). [89]Maßgeblich ist also grundsätzlich das Recht des Belegenheitsortes der Sache. [90]
Das Belegenheitsrecht bestimmt, was Bestandteil der Sache ist bzw. inwieweit bestimmte Sachen rechtlich selbständig sind, die Arten von Sachen und ihre Verkehrsfähigkeit sowie die Arten der dinglichen Rechte. [91]Auch bestimmt es über die Verfügung in Gestalt der Entstehung, Änderung, dem Untergang und den Übergang dinglicher Rechte [92]bis hin zur Frage der erforderlichen Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit. [93]Diese Rechtsfragen sind erst im Rahmen der Anwendung des berufenen Sachstatuts zu beantworten, nicht schon auf Tatbestandsebene des Art. 43 EGBGB bei der Anknüpfung. [94]
Grundsätzlich bleiben Sachenrechte trotz Verbringung der Sache bestehen. Allerdings gilt dies nicht, wenn diese mit der sachenrechtlichen Grundstruktur des neuen Belegenheitsstaates nicht verträglich sind. [95]Außerdem ist nach Art. 43 Abs. 3 EGBGB für die Beurteilung gänzlich auf das neue Statut abzustellen, wenn unter dem ursprünglich geltenden Statut nicht sämtliche Voraussetzungen der dinglichen Änderung erfüllt waren, das Recht an der Sache also nicht bereits vorher erworben wurde.
Читать дальше