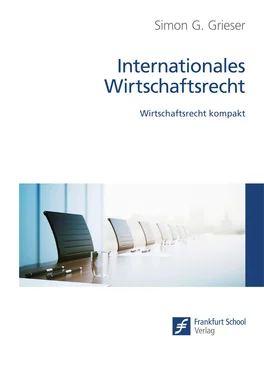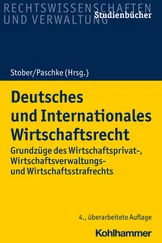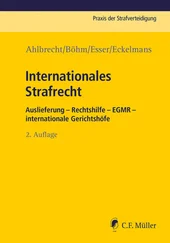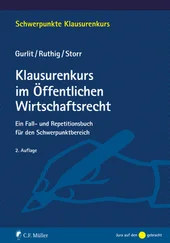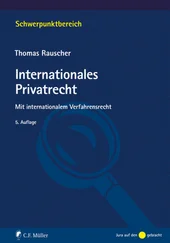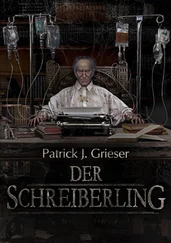6.12 Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
6.12.1 Übersicht über das DSU
6.12.2 Ablauf eines Verfahrens
6.12.3 Durchsetzung von Entscheidungen
6.12.4 Private als Parteien im Streitverfahren
7 Internationales Leasingübereinkommen von Ottawa (1988)
7.1 Allgemeines
7.2 Anwendungsbereich des Übereinkommens
7.2.1 Sachlicher Anwendungsbereich
7.2.2 Räumlicher Anwendungsbereich
7.3 Grundverständnis des Finanzierungsleasingvertrages nach dem Übereinkommen
7.3.1 Sui-generis-Charakter
7.3.2 Verbindung zwischen dem Liefervertrag und dem Leasinggeschäft
7.3.3 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
7.4 Ausschluss des Übereinkommens/Abdingbarkeit
7.5 Auslegung
7.6 Anwendung des UN-Kaufrechts
7.7 Anwendung von anderen internationalen Verträgen
7.8 Schlussbemerkungen
8 Internationales Zivilverfahrensrecht
8.1 Begriffsbestimmung
8.2 Relevante Rechtsquellen und ihre Rangfolge
8.2.1 Quellen
8.2.2 Anwendbarkeit der Brüssel-Ia-VO
8.3 Allgemeiner Gerichtsstand
8.4 Besondere Gerichtsstände
8.4.1 Vertragsrecht
8.4.2 Unerlaubte Handlungen
8.4.3 Gerichtsstand der Niederlassung
8.4.4 Gerichtsstand des Sachzusammenhangs/Konnexität
8.4.5 Verbrauchergerichtsstand
8.5 Ausschließliche Gerichtsstände
8.6 Gerichtsstandsvereinbarungen
8.7 Rügelose Einlassung
8.8 Familienrechtliche und erbrechtliche Streitigkeiten
8.9 Forum non conveniens – Versagung internationaler Zuständigkeit
9 Schiedsverfahrensrecht
9.1 Einführung
9.2 Abgrenzung des Schiedsverfahrens
9.2.1 Abgrenzung zum Adjucationsverfahren
9.2.2 Abgrenzung zur Mediation
9.2.3 Abgrenzung zum Schiedsgutachten
9.2.4 Abgrenzung zur Schlichtung
9.3 Arten von Schiedsgerichtsbarkeiten
9.4 Arten von Schiedsverfahren
9.4.1 Ad-hoc-Schiedsgerichte
9.4.2 Schiedsinstitutionen
9.5 Vorteile von Schiedsverfahren
9.6 Ablauf von Schiedsverfahren nach deutschem Recht
9.6.1 Schiedsvereinbarungen
9.6.2 Notwendiger Inhalt
9.6.3 Fakultativer Inhalt
9.6.4 Konkurrenzklauseln
9.6.5 Mängel und Unwirksamkeit
9.6.6 Reichweite der Schiedsvereinbarung
9.6.7 Wirkung der Schiedsvereinbarung
9.6.8 Entscheidung über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts
9.6.9 Schiedsrichter
9.6.10 Anzahl der Schiedsrichter und Bestellungsverfahren
9.6.11 Auswahl der Schiedsrichter
9.6.12 Ablehnung der Schiedsrichter
9.6.13 Schiedsrichtervertrag
9.6.14 Ablauf des Verfahren
9.7 Rangfolge der schiedsverfahrensrechtlichen Rechtsquellen
9.8 Ablauf nationaler Schiedsverfahren
9.9 Schiedsspruch und dessen Wirkung
9.9.1 Entscheidung des Rechtsstreits
9.9.2 Inhalt und Form des Schiedsspruchs
9.9.3 Wirkungen des Schiedsspruchs
9.9.4 Berichtigung, Auslegung und Ergänzung des Schiedsspruchs
9.9.5 Aufhebung von Schiedssprüchen
9.10 Vollstreckbarerklärung inländischer Schiedssprüche
9.11 Anerkennung und Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche
9.12 Ablauf von Schiedsverfahren nach den ICC Rules
9.12.1 Einleitung des Schiedsverfahrens
9.12.2 Errichtung des Schiedsgerichts
9.12.3 Auswahl und Ernennung der Schiedsrichter
9.12.4 Sonderfälle und Eingreifen des Schiedsgerichtshofs
9.13 Durchführung des Schiedsverfahrens
9.13.1 Schiedsauftrag
9.13.2 Sachverhaltsfeststellung durch das Schiedsgericht
9.13.3 Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
9.14 Erlass des Schiedsspruchs und Abschluss des Verfahrens
9.14.1 Erlass des Schiedsspruchs
9.14.2 Abschluss des Verfahrens
9.15 Verfahren nach dem Erlass des Schiedsspruchs
Literatur
Reihe „Wirtschaftsrecht kompakt“
Das Internationale Wirtschaftsrecht ist Ausdruck einer weltweit verzahnten Wirtschaft und versucht, für diese rechtliche Rahmenbedingungen herzustellen. Vielfach sind durch supranationale Übereinkünfte Grundlagen für eine gesetzliche Basis von internationalen Handelsbeziehungen geschaffen worden. Dennoch sind einige Bereiche nur fragmentarisch geregelt.
Im Folgenden werden verschiedene Bereiche des grenzüberschreitenden Wirtschaftsrechts in ihren Strukturen und Konzepten dargestellt.
Der Autor dankt für die Unterstützung und Mühen Frau Magdalena Anic, Frau Joelle Payer, Frau Laura Gerber, Frau Irmela Dölle, Frau Jael Karck und Herrn Lennart Weissmann.
Frankfurt am Main, im Februar 2021 Dr. Simon G. Grieser
Dr. Simon G. Grieser ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter Büro der internationalen Kanzlei Reed Smith LLP. Er berät nationale und internationale Mandanten im Bereich des Bank- und Finanzrechts. Sein besonderer Fokus liegt auf Transaktionen mit notleidenden und nicht-notleidenden Kredit-Portfolien und Fragen des Bankaufsichtsrechts.
Dr. Simon G. Grieser ist Autor verschiedener Abhandlungen und Artikel zu Themen des Bank-, Kapitalmarkt- und Finanzrechts sowie Mitherausgeber der im Frankfurt School Verlag erscheinenden „Frankfurter Reihe zur Bankenaufsicht“.
1 Deutsches Internationales Privatrecht
1.1 Begriffsbestimmung
Das Internationale Privatrecht (IPR) ist Kollisionsrecht [1](auch Verweisungsrecht oder Rechtsanwendungsrecht genannt). Es dient bei einem Sachverhalt mit Auslandsberührung der Bestimmung des anzuwendenden Sachrechts – also welche nationale Privatrechtsordnung zur Klärung der Rechtsfrage anzuwenden ist. [2]Es handelt sich um nationales Recht, welches von Amts wegen anzuwenden ist. [3]
1.2 Relevante Rechtsquellen und ihre Rangfolge
1.2.1 Quellen
Relevante Rechtsquellen des deutschen IPR sind die Regelungen der Art. 3 bis 46d EGBGB samt deutscher Spezialgesetze, [4]Gewohnheits- bzw. Richterrecht (Stellvertretung, Gesellschaften/juristische Personen), die europäischen ROM-Verordnungen – insbesondere ROM-I-VO (vertragliche Schuldverhältnisse) und ROM-II-VO (außervertragliche Schuldverhältnisse) – und unmittelbar anwendbare Staatsverträge (v.a. Haager Abkommen, UN-Übereinkommen und bilaterale Übereinkommen). Daneben können auch die ROM-III-VO (Ehescheidungen) und die EuErbVO von Bedeutung sein. Auch gibt es kollisionsrechtliche Staatsverträge der EU – geschlossen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen – mit der Qualität von sekundärem EU-Recht. [5]Sie sind in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar (Art. 216 Abs. 2 AEUV). [6]
Das einst abschließend relevante EGBGB, samt deutscher Spezialgesetze, wurde aufgrund der Subsidiaritätsklausel in Art. 3 Nr. 1, Nr. 2 EGBGB weitestgehend von den europäischen ROM-Verordnungen und durch unmittelbar anwendbare Staatsverträge abgelöst. [7]
Es gilt folgende Rangfolge:
unmittelbar anwendbare ROM-Verordnungen der EU (Art. 3 Nr. 1 EGBGB);
innerstaatlich unmittelbar anwendbare völkerrechtliche Vereinbarungen (Art. 3 Nr. 2 EGBGB);
Kollisionsnormen nach Art. 3 bis 46d EGBGB und Gewohnheits- bzw. Richterrecht.
1.3 Kollisionsnormen
1.3.1 Allgemein
Kollisionsnormen sind grundsätzlich wie Sachnormen aufgebaut. Sie enthalten einen abstrakten Tatbestand sowie eine abstrakte – an den Tatbestand anknüpfende – Rechtsfolge. Anders als bei Sachnormen weisen die Tatbestände jedoch eine größere Abstraktionshöhe auf als nationale Sachnormen. [8]Auch beschränkt sich die Rechtsfolge der Kollisionsnormen auf den bloßen Verweis in eine bestimmte Rechtsordnung, nach deren Regelungen dann die finale Rechtsfolge zu finden ist. [9]
Читать дальше