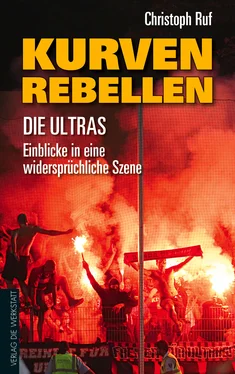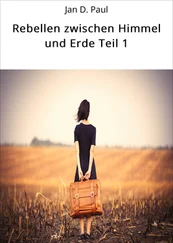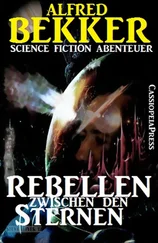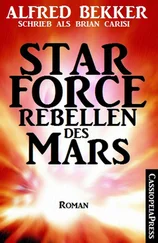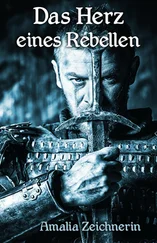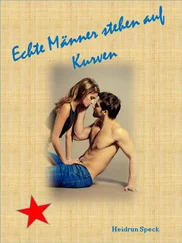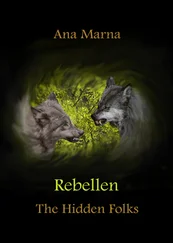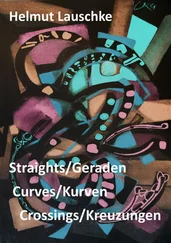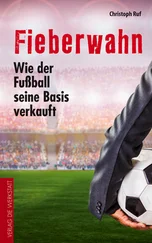Drei Monate später. Samstag, zehn Uhr, in fünfeinhalb Stunden beginnt das Heimspiel der Bayern gegen den SC Freiburg. Das Oktoberfest beginnt hingegen erst in fünf Monaten. Doch die Leute, die hier am Hauptbahnhof zu Hunderten und Tausenden aus ICEs und Nahverkehrszügen steigen, sehen so aus, als planten sie einen Wiesenbummel. Mal Jeans, mal Lederhose über grobwollenen Socken, auch der Sepplhut ist gerne genommen, das Fantrikot, neueste Edition natürlich, Pflicht. Praktischerweise hat der FC Bayern unter der Rolltreppe, die vom Bahnhof zu den U- und S-Bahnen führt, einen Riesenfanshop eingerichtet: Vom Quietscheentchen bis zum totschicken Bademantel gibt es hier alles, was die Bayern-Fans aus Mittelfranken, Nordhessen und dem Sauerland gerne nach Hause mitnehmen: die volle Einkaufstüte schnell im Schließfach verstauen und ab zum Marienplatz, noch ein paar Bier trinken, ehe das Spiel gegen den langweiligen Gegner losgeht. Die mitgebrachte Freundin, selbstredend im pinken Bayern-Look, wird schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wenn der FC Bayern ruft, strömt die Provinz nach München. Und die Provinz gibt sich nicht die geringste Mühe zu verheimlichen, woher sie kommt.
Elf Uhr: Die Sonne scheint, es ist ruhig. Vor dem orangenen Streetwork-Bus in der Nähe der Allianz Arena stehen ein paar Ultras herum, andere haben sich ein Augustiner oder ein Wasser geschnappt und sich ins Gras gesetzt. Man unterhält sich.
Dann kommt Simon aus dem Bus. Er hat sich seit dem letzten Treffen einen Bart stehen lassen. Und das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat. Das Verhältnis zwischen aktiver Fanszene und Verein ist noch einmal deutlich abgekühlt. „Da drinnen“, sagt Simon und zeigt auf die Allianz Arena, „trifft sich gerade der Arbeitskreis Fandialog“. Doch bei dem vom Verein bestellten Mediator, Prof. Dr. Wolfgang Salewski, einem Polizeipsychologen, der sich 1977 als Verhandlungsführer bei der Entführung der „Landshut“ in Mogadischu einen Namen machte, haben die Ultras offenbar keine guten Karten: Im August 2013 schlägt er im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vor, „den gesamten Block neu zu organisieren: neue Leute, neue Lieder. Dann baut sich da wieder was auf.“ Als ob man eine Fankurve umstrukturieren könnte wie das Sortiment eines Kaufhauses.
Die Schickeria-Leute haben trotzdem in den letzten Monaten immer wieder brav einen Vertreter in die AG entsandt, obwohl sie schon immer den Eindruck hatten, dass sie da, wenn überhaupt, nur als Feigenblatt erwünscht sind. Denn sonst sind 30 Vertreter größerer Fanklubs aus dem Umland eingeladen, ausgesucht vom Verein. Fans, für die es die größte Freude ist, wenn einmal im Jahr die Profis zum „Traumspiel“ gegen den Fanklub antreten, und die der Verein großzügig mit Tickets versorgt. Mit der Schickeria tut sich der Verein da schon schwerer. Immer diese kritischen Fragen, diese Transparente, dieser Anspruch, mitreden zu wollen. Und keine Besänftigungsmöglichkeit weit und breit. Die Schickeria braucht kein „Traumspiel“, sie organisiert jeden Sommer ihr eigenes Fußballturnier zum Gedenken an den von den Nazis verfolgten Ex-Präsidenten Kurt Landauer. Doch so ganz können sie auf die Ultras eben doch nicht verzichten. Ohne sie wäre endgültig Totenstille im weiten Rund.
Schon heute – mit den paar hundert Aufrechten im Bayern-Block – hört man in der Mitte des Stadions deutlich lauter die Gäste- als die Heimfans – und das, obwohl der FC Bayern die in weiser Voraussicht schon in die entlegenste Ecke des Stadions verfrachtet hat. „Ihr seid nur Fußballkulisse“, singen die 7.000 Freiburger Fans in Richtung der über 63.000 Bayern-Anhänger. Es ist keine Beleidigung, sondern die Feststellung einer Tatsache. Kurzum: Der Verein braucht die Ultras. Er will sie nicht ganz aus dem Stadion vertreiben. Aber er will mit aller Macht verhindern, dass sie mehr werden. Dabei hat der FC Bayern sowieso schon den kleinsten Stehplatzblock der Liga, der ist fast komplett besetzt mit Jahreskarteninhabern, die die vergleichsweise günstigen Plätze nicht verlassen wollen. Für Stimmung wollen sie aber nicht sorgen. Junge Leute, die zu den Ultras wollten, hatten bisher nur die Möglichkeit, sich ein Ticket für einen anderen Stadionbereich zu kaufen – und sich dennoch zu den Ultras zu gesellen. Doch genau das geht jetzt nicht mehr. Um das zu verhindern, hat der Verein extra zusätzliche Drehkreuze vor dem Block installiert.
Und wenn man den Ultras einen eigenen Block einräumen würde? Simon lacht. Auch er findet es skurril, dass ein Verein, der 37 Millionen Euro für Mario Götze hat, sich nicht weitere Stehplätze leisten mag. Letzte Saison, beim Spiel gegen Bate Borisov, haben die Ultras mal ein Zeichen gesetzt und sind einfach weggeblieben. Die Stimmung war gespenstisch. Noch direkt unter dem Stadiondach waren die Rufe von Co-Trainer Peter Herrmann gut zu vernehmen.
Am 28. Januar 2013 um 17 Uhr 30 blickten die Zuschauer im Stuttgarter Stadion wie gebannt Richtung Block 61. Dort reckten tausende Bayern-Fans eine aufwendig gestaltete Stoffbahn der Schickeria in die Höhe. Die Aufschrift erinnerte an einen Mann, der fast schon in Vergessenheit geraten war: Richard „Dombi“ Kohn. Unter der Regie des jüdischen Coachs holten die Bayern 1932 den ersten von mittlerweile 23 nationalen Meistertiteln. „Ein tolles Erlebnis“, fand Eberhard Schulz von der Evangelischen Versöhnungskirche in Dachau, der mit den Münchner Fans nach Stuttgart gereist war. „Das Engagement der Schickeria gegen Rassismus und Antisemitismus ist absolut glaubwürdig“, sagt Schulz, der den „Erinnerungstag“ des deutschen Fußballs initiiert hat, mit dem an diesem Wochenende in vielen Stadien des Holocausts gedacht wurde. Die Schickeria sei seit Jahren Mitglied im antifaschistischen europäischen Fan-Netzwerk FARE („Football against racism in Europe“).
Wenige Tage zuvor waren 200 Gäste ins FCN-Vereinszentrum gekommen, um zu hören, was Evelyn Konrad, Tochter des einst von den Nazis vertriebenen Coachs Jenö Konrad, über ihren Vater zu berichten hatte. Dass die eloquente 84-Jährige überhaupt in die Stadt zurückkehrte, die sie als Dreijährige verließ, ging auf eine Initiative der Gruppe „Ultras Nürnberg“ zurück. Acht Wochen lang arbeiteten mehrere Dutzend von ihnen an der Choreografie zum Gedenken an Jenö Konrad: Sie nähten schwarze und rote Stoffbahnen zusammen und verteilten auf Tausenden von Stadionsitzen verschiedenfarbige Pappen, die emporgereckt ein gigantisches Mosaikbild ergaben. Am 17. November schließlich präsentierten sie zum Heimspiel gegen den FC Bayern eine Choreografie, die mehrere tausend Euro gekostet hatte. „Diese Geste gegen Antisemitismus und Rassismus wurde medial fast nicht gewürdigt“, sagt FCN-Manager Bader. Es sei aber ein „Gebot der Redlichkeit“, dass sich nun nicht ausschließlich der Verein für seine Aktivitäten feiern lasse: „Ohne das Engagement der Ultras wären wir nicht so konsequent aktiv geworden.“
Ähnlich würden sich wohl die Manager vieler anderer Profivereine äußern. Die „Supporters“ des Bundesligisten Hamburger SV finanzierten 2007 und 2008 die Sonderausstellung „Die Raute unter dem Hakenkreuz“. Beim Lokalrivalen FC St. Pauli sorgte die Fanbasis-Organisation „Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder“ für die Umbenennung des Stadions, das bis 1998 nach einem NSDAP-Mitglied benannt war. Auch der Beitritt des Vereins zum Entschädigungsfonds jüdischer Zwangsarbeiter geht auf eine Faninitiative zurück. In Mainz sorgte der Fan-Dachverband „Supporters“ dafür, dass die Zufahrtstraße zum neuen Stadion nicht „Arenastraße“ (wie von der Politik geplant) heißt. Sie trägt nun den Namen des nach Auschwitz deportierten ehemaligen Mainz-05-Präsidenten Eugen Salomon. Keine Einzelfälle, der Hamburger Journalist Werner Skrentny führt in seinem Buch „Julius Hirsch. Nationalspieler. Ermordet.“ viele weitere Beispiele dafür auf, wie sich Fans für eine ehrliche Erinnerungskultur engagieren. Herumgesprochen hat sich das allerdings scheinbar noch nicht; das Image von Fußballfans und insbesondere der Ultras könnte schlechter kaum sein.
Читать дальше