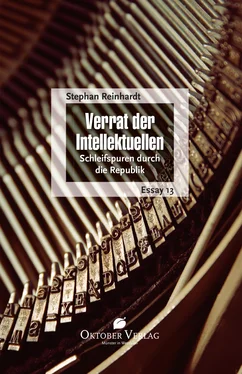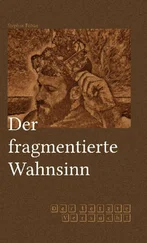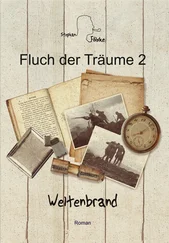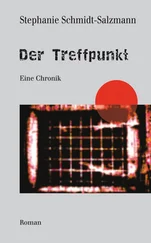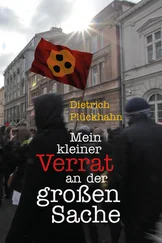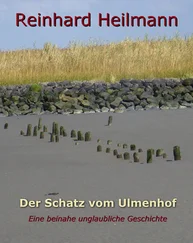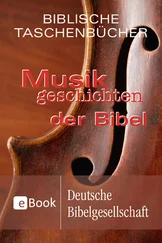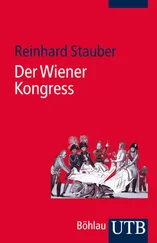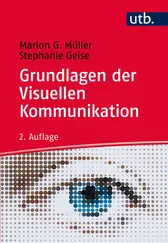Es ist auch kein Verrat, wenn die »New York Times« im Dezember 2005 über gesetzeswidrige Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA berichtet und Präsident George W. Bush daraufhin diese Enthüllung brandmarkt als »Verrat von Geheimnissen« und »schändliche Tat« der Presse. 50Oder wenn der Pentagon-Mitarbeiter Daniel Ellsberg 1971 die streng geheimen Seiten der »Pentagon Papers« – die intern dokumentierten, daß der Vietnamkrieg für die USA nicht mehr zu gewinnen war – der »New York Times« zuspielt. Ebensowenig wie 1963 der die »Spiegel«-Affäre auslösende Bericht über das »Fallex«-Manöver ein – so Adenauer damals – »Abgrund von Landesverrat« gewesen ist. Im Gegenteil: Die Realisierung der Pressefreiheit durch Veröffentlichung von tatsächlichen oder angeblichen »Geheimnissen« dient in der Regel der Stärkung und Bewahrung der Demokratie. Das gilt auch heute: Es sei, erklärt zum Beispiel der US-Ökonom Daniel Ellsberg, Preisträger des alternativen Nobelpreises 2006, angesichts der US-Pläne hinsichtlich des Einsatzes sogenannter bunkerbrechender A-Bomben, »höchste Zeit, Verrat zu begehen«, und er fordert US-Beamte und Militärs auf, Geheimdokumente zu »verraten«. 51
Fälle dieser Art gab und gibt es zahlreiche und wird es immer wieder geben: Eine oder mehrere Personen, eine Behörde, ein Geheimdienst oder eine Regierung brechen Recht aus Fehleinschätzung, Arroganz der Macht, purem Egoismus oder um eines vermeintlich höheren Gutes willen und stigmatisieren den zum Verräter, der Licht ins Dunkel zu bringen versucht. Um Zeit zu gewinnen und fürs erste Entlastung zu schaffen, erst einmal der Gegenangriff. Und dabei das generelle Argumentationsmuster: Schuld hat natürlich der Bote, der Überbringer der schlechten Nachricht, der, der sie mitteilt sowie die Medien, die sie verbreiten, nicht ihr Verursacher. Der oder das Verurteilenswerte sind – so zum Beispiel Martin Walser – nicht die Brandstifter von Hoyerswerda, sondern Fernsehreporter, die solche Bilder zeigen. Oder schädlicher fürs Ansehen als der Skinhead in Brandenburg oder Berlin-Lichtenhagen ist nach Meinung von Innenminister Jörg Schönbohm derjenige, der wie Karsten-Uwe Heye hinweist auf No-go-Areas für Farbige und Türken. Ein Muster, dessen sich heute reflexhaft viele bedienen. 52Dergleichen Spiele mit einer urdemokratischen Institution wie der Presse sind heute gang und gäbe. Abgeladen wird beim vermeintlich Schwächsten: den Medien. Festzuhalten aber bleibt: Am jeweiligen Fall und dem Inhalt der Ansichten entscheidet sich, ob der Verrat begeht, der seine Überzeugungen ändert, oder ob der es tut, der an ihnen festhält. Gleichwohl: Es gibt Grenzen für Gedanken-, Einstellungs- und Gewissenswechsel. Nicht alles ist erlaubt: Ständiger Wechsel – frei von jeder Gesinnung und Moral – riecht nach Opportunismus und Verrat.
Den »Verrat der Intellektuellen« hat Julien Benda in seinem gleichnamigen Schlüsselessay in der ersten Ausgabe von 1927 zunächst für die politische Rechte beschrieben, dann nach den Verbrechen Stalins in der Neuauflage von 1958 auch für die dogmatische Linke. Die größten intellektuellen Verratsformen des 20. Jahrhunderts waren Nationalsozialismus und Faschismus sowie die Regime des dogmatischen totalitären Staatskommunismus. Formen dieses Verrates begeht, so einer der zentralen Sätze Bendas, wer nicht anerkennt, »daß das in der Erklärung der Menschenrechte oder in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung niedergelegte politische Ideal in eminenter Weise ein Ideal ist« 53. Das heißt, wer die Ideen von Aufklärung und Französischer Revolution – die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sowie die »Achtung vor der Gerechtigkeit, vor der Person und vor der Wahrheit« 54– geringschätzt oder verachtet. Benda fährt an späterer Stelle fort: Verrat ist »die Verherrlichung« des »totalitären Staates, in dem definitionsgemäß der Begriff der Person und a fortiori der ihrer Rechte verschwindet; des Staates, dessen Seele jene Maxime ausdrückt: Du bist nichts, dein Volk ist alles … Im übrigen ist nicht zu bestreiten, daß die Abschaffung der Rechte des Individuums einen Staat erheblich stärkt. Fragt sich nur, ob es Aufgabe des Intellektuellen ist, einen Staat zu stärken.« 55Das heißt: Diktaturen sind leichter zu »regieren«. Die Anweisung von oben seitens des Diktators – einer Person und/oder einer Partei – ist nach unten hin auszuführen bei Strafe im Nichtbefolgungsfalle. Macht zu begrenzen dagegen ist Kernelement der Demokratie. John Lockes und Montesquieus Teilung der Gewalten, Meinungsfreiheit, Vielfalt der Parteien, das Kontrollsystem der »checks and balances«, Delegation von Macht auf Zeit, periodische Wahlen, Gewerkschaften und Verbände – all diese Vorkehrungen haben den einen Sinn, so führt Johano Strasser Bendas Gedanken weiter, nämlich »den Zugriff der Mächtigen zu limitieren und damit auch die Folgen von Irrtümern und Fehlentscheidungen möglichst gering zu halten«. 56Durch Interessen- und Meinungsstreit zustande gekommene demokratische Entscheidungen erlauben im Widerspruchsfalle (entsprechende finanzielle Ausstattung vorausgesetzt) noch das Anrufen von Gerichten. Im Unterschied zur Diktatur impliziert die Demokratie jedoch auch, so Benda, »gerade kraft ihres Oktroi der individuellen Freiheiten ein Moment der Unordnung« 57. Montesquieu hat es so auf die Pointe gebracht: »Wenn Sie in einem Staat keinerlei Lärm von Streitigkeiten vernehmen, so können Sie sicher sein, daß es in ihm keine Freiheit gibt.« 58Eine freie Regierung in einem freien Land dagegen ist »eine ständig in Auseinandersetzungen verwickelte«. Oder, so illustriert selbst Rüdiger Safranski in seinem in der konservativen Programmschrift »Die selbstbewußte Nation« abgedruckten Essay »Destruktion und Lust. Über die Wiederkehr des Bösen« den Sachverhalt: Sie bedarf der »Bürgergesinnung«, denn »Demokratie als Lebensform ist stets gefährdet, weil sie auf schwankendem Grund errichtet werden muß, auf Pluralität, Selbstrelativierung, Kompromiß, wechselseitiger Anerkennung.« 59Daß sie deshalb »Ausnahme« und »Glücksfall« sei, wie Safranski gleichzeitig aussagt, verrät mangelndes Vertrauen in sie. Gleichwohl: Montesquieu, Benda und Strasser lesen jenen in der Bundesrepublik die Leviten, die mit der offenen Gesellschaft auf Kriegsfuß standen und stehen oder sie mißverstehen: wie zum Beispiel der konservative ZDF-Journalist und Theologe Peter Hahne, der in seinem Bestseller »Schluß mit lustig: Das Ende der Spaßgesellschaft« lauthals »unsere feige Kompromißgesellschaft« beklagt. 60
Da es im menschlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben Gegensätze und Widersprüche gibt, die entweder nicht oder nicht ohne weiteres auflösbar sind, müssen sie miteinander vermittelt werden. Zum Beispiel sind die Bedürfnisse des Staates und die Freiheiten des Einzelnen oder Freiheit und Chancengleichheit unter dem Leitbegriff sozialer Gerechtigkeit aufeinander zu beziehen und auszugleichen. Dieses Gegeneinander der unterschiedlichsten Interessen erzeugt in den offenen Gesellschaften der Demokratien Montesquieus »Lärm der Streitigkeiten« 61.
Der Berliner Medientheoretiker Norbert Bolz findet für diesen Streit, für diese wechselseitige Einschränkung der Ansprüche adäquate Worte: »Anspruch steht gegen Anspruch, Theorie gegen Theorie. Wer hier Gewißheit behauptet, weckt Zweifel. Wer dagegen zweifelt, schafft Vertrauen. Modern entsteht Freiheit nämlich gerade durch den Widerstreit der Dogmen, durch die wechselseitige Einschränkung der Ansprüche.« 62
Streit, Konflikt, Nichtübereinstimmung sind Alltag und Norm rechtsstaatlicher Demokratien. Die normative Grundlage demokratischer, freiheitlicher Ordnung ist, so räumt der konservative Publizist Richard Herzinger in seinem Essay »Republik ohne Mitte« selbstredend ein, der »geregelte, diskursiv und gewaltfrei ausgetragene Konflikt« 63. Für Herzinger – in den 7Oer Jahren aktives Mitglied der trotzkistischen Gruppe Internationaler Marxisten – hat die offene westliche Demokratie jedoch einen prinzipiellen Mangel: Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß sie kein verbindliches Werte- und Sinnzentrum mehr hat. Dort, wo man das »Kraftzentrum« vermutet, von dem aus sich »die politisch-moralische Einheit der Gesellschaft steuern lasse, befindet sich – nichts« 64. Ihr »Identitätskern«, ihre Mitte ist »leer«. Denn alle Werte können in ihr »in Frage gestellt werden« 65. Aber ist es so, daß die »Mitte«, das »Kraftzentrum«, wirklich ganz »leer« – ohne ideellen und moralischen Kern – ist? Gibt Herzinger – der sonst das Alphabet der Verwestlichung und der repräsentativen Demokratie zu buchstabieren versteht – nicht ohne Not Terrain frei? Gibt es da nicht noch ein Lebenselixier? Die Grundwerte der Verfassung zum Beispiel? Von ihnen oder von Verfassungspatriotismus spricht Herzinger, heute politischer Redakteur der »Welt am Sonntag«, nicht.
Читать дальше