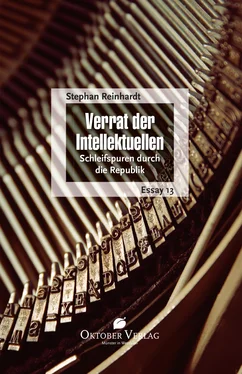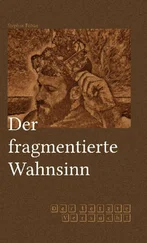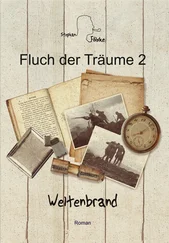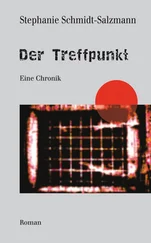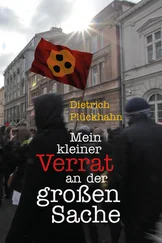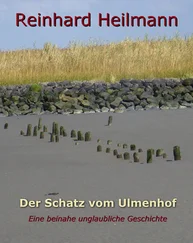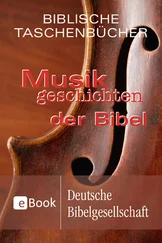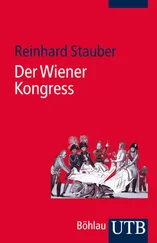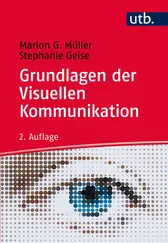Ist andererseits, wer in seinen Meinungen, Ansichten und Handlungen »stets als ein und derselbe auftritt«, immer und vorbehaltlos »wahrhaft groß«? Zum Beispiel in der ehemaligen DDR? Viele hofften zu Anfang auf einen gesellschaftlichen Neubeginn. Endlich etwas anderes, als bewußter Gegenentwurf zum Nationalsozialismus: eine sozialistische Demokratie, in der die Macht der wirtschaftlich Stärksten und Größten (wie in den Westzonen ebenso 1947 im Ahlener CDU-Programm formuliert) gebrochen wird. Aus der Emigration zurück kamen deshalb etliche nicht in die Bundesrepublik – Adenauer zeigte kein Interesse an den Exilanten und ließ keine einzige Aufforderung zur Rückkehr ergehen –, sondern in die »Ostzone«/DDR: Bert Brecht, Paul Dessau, Ernst Bloch, Stephan Hermlin, Hans Mayer, Anna Seghers, Arnold Zweig et alii. Auch der 1933 geborene Reiner Kunze, von 1955 bis 1959 wissenschaftlicher Assistent an der Fakultät für Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig, erklärte sich vehement für das neue Gesellschaftsmodell DDR. Kunze entpuppte sich schließlich als fanatischer Stalinist. So daß Wolf Biermann in der »Zeit« feststellte: »Kunze wurde als brutaler stalinistischer Einpeitscher von den besseren Studenten gefürchtet.« 37
Aber dann korrigierte sich Kunze. Seinen ›Gesinnungswechsel‹ dokumentierte er selbst in seinem 1993 veröffentlichten Tagebuch »Am Sonnenhang«, indem er aus seiner Stasiakte zitierte: »In dieser Zeit« (1955 bis 1959) »vollzog sich bei Kunze eine politisch-ideologische Wandlung und eine Abkehr vom Marxismus-Leninismus.« 38Dergleichen Wechsel von Meinungen, Ansichten, Überzeugungen, Weltanschauungen sind in der Regel – handelt es sich um Irrtümer oder dogmatische Weltbilder – aller Ehren wert. Korrektur also von falschen Dogmen, Fanatismen, Fehlansichten ist kein Verrat.
Auch in der (westdeutschen) Demokratie war und ist Meinungs-Korrektur keineswegs von vornherein Verrat. Wenn zum Beispiel Franz Xaver Kroetz, 1946 in München geboren, 1972 als Sechsundzwanzigjähriger der DKP beitritt, im Landesvorstand seiner Partei sich in die Programm-Kommission wählen läßt und 1980 wieder austritt, ist das zwar in den Augen seiner Genossen Verrat. Tatsächlich aber ist es bessere Einsicht. Warum wurde der »bekannteste Kommunist Bayerns« DKP-Mitglied? Kroetz, dessen Vater Nazi war: »Ich hätte meine Eltern mit zwei Sachen treffen können: Wenn ich schwul geworden wäre oder Kommunist. Schwul ging nicht, also wurde ich Kommunist. Sicher aus Protest.« 39– Wie aber ist der Fall des Hamburger Schriftstellers Peter Schütt zu beurteilen, der 1968 in Hamburg die DKP mitbegründete, Mitglied des DKP-Parteivorstandes und Bundessekretär des DKP-nahen »Demokratischen Kulturbundes« wurde? Als Schütt, der »DKP-Hofdichter«, sich zu Gorbatschows Reformkurs bekannte, schloß ihn die DKP-Spitze im September 1988 aus dem Parteivorstand aus, woraufhin er kurz darauf aus der Partei austrat. Verrat oder bessere Einsicht? Bessere Einsicht. Aber war dem nicht auch ein Anflug von Renegatentum beigemischt, wenn Schütt sich nun als Forum für seinen Wechsel-Bericht ausgerechnet die »FAZ« aussuchte? Und dort sein Wechselbekenntnis drucken ließ: »Ich wurde nach Vietnam eingeladen und schrieb daraufhin mein erstes richtiges Buch. Die Schreckensbilder dieses Krieges haben lange nachgewirkt und mich in jenem Schwarzweißdenken bestärkt, das mich so lange blind gemacht hat gegenüber der Verbrechensgeschichte des eigenen Lagers. Für mich war der Kapitalismus das Reich des Bösen, verantwortlich für Auschwitz und My Lai, und im Kommunismus sah ich den einzigen Weg, die Menschheit von allen Weltübeln zu erlösen. In den kalten Zeiten des Ost-West-Konflikts gab mir die Partei zugleich Nestwärme und das stolze Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein, komme, was da kommen mag. Eine Zeitlang war ich so etwas wie der Liebling der Partei, und ich habe den Beifall der Genossen auch genossen.« 40Einfachaufteilung der Welt in Schwarz und Weiß und Suche nach Nestwärme aus Naivität und Narzißmus – ein intellektuelles Verratssyndrom?
Auch der Wechsel der Mitgliedschaft in einer Partei – obwohl auch hier die Vokabel »Verrat« schnell auf der Zunge liegt – ist nicht von vornherein Verrat. Wenn zum Beispiel »Grünen«-Mitgründer Otto Schily sein Parteibuch zurückgibt und zur SPD wechselt, ist das nicht Verrat. Darf nicht gewechselt werden in eine andere Partei – so wie es etliche getan haben – Wehner, Brandt, Heinemann, Lafontaine (dem Müntefering ein sattes »Verräter« nachrief)? Aber riecht es nicht doch nach Gedanken-Verrat, wenn der grüne »Überläufer« Otto Schily sich als Innenminister der neoliberalen Schröder-SPD von 1998 bis 2005 in seine neue Rolle geradezu hineinsteigert: nämlich den unbeugsamen Sheriff spielt, mit grimmiger Miene und vor Entschlossenheit schneidender Befehls-Stimme? Und dabei gewöhnungsbedürftige Unionshardliner wie Bayerns damaligen Innenminister Günther Beckstein noch rechts überholt? Nach dem 11. September gab Otto Schily markige Worte am Fließband von sich. Ihr Tenor: Staat und Safety first. In seltener Militanz forderte Schily bei der Abwehr des Terrorismus die vorbeugende Sicherheitshaft ohne Tatverdacht und sogar das Recht auf präventive Tötung: »Wenn ihr den Tod so liebt, dann könnt ihr ihn haben.« 41Verlangte Auffanglager für nordafrikanische Flüchtlinge in Nordafrika. Drängte auf ein Luftsicherheitsgesetz, damit der Staat, in der Hoffnung, andere zu retten, unschuldige Bürger in einem entführten Flugzeug abschießen dürfe. Bis das Bundesverfassungsgericht den geplanten Abschußparagraphen für nichtig erklärte und Schily auf die Verfassung verwies, auf den Kantischen Grundsatz der Menschenwürde: Nie dürfe der Mensch Mittel zum Zweck sein, auch wenn der Zweck als gut erscheint: »So entsetzlich die Bedrohung auch sei, wie heftig al-Quaida auch an der gewohnten Weltordnung rüttele, Verfassung bleibe Verfassung«, kommentierte die »Zeit« 42. Der in seinem Innen-Ministerium wegen seines Führungsstils als cholerischer »Kotzbrocken« 43Titulierte absolvierte eine verblüffende Verratskarriere: vom linken Radikaldemokraten zum rechten Law-and-order-Apostel. Kein Verrat? Nur intelligentes Gegensteuern aus besserer Einsicht? Oder ganz gewöhnlicher Opportunismus sowie notwendige politische Überlebensflexibilität?
Und ist es nicht doch auch Verrat, wenn der ehemalige Sozialist Manès Sperber 441983 in seiner Dankesrede zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zur atomaren Selbstverteidigung des freien Europa gegen die Sowjetunion aufruft – gegen das »Reich des Bösen«? Atomar? War, ist das besonnen oder gar klug? Und Sperbers Rundumschimpfe auf die Achtundsechziger als fünfter Kolonne Moskaus – war das »groß« und fair? Sperber zeigte sich dabei, wie ihm der Freiburger Publizist Ludger Lütkehaus zu Recht entgegnete 45, in »selbstgewählter Verblendung« als »Prototyp eines Renegaten«. War das nicht intellektueller Verrat, wenn Sperber erklärte: »Wir müssen leider selbst gefährlich werden, um den Frieden zu wahren«? Gefährlich werden mit dem Einsatz von Atomwaffen? Die um ein Mehrfaches grausamer sind als die von Hiroshima und Nagasaki? Sperber heizte emotional an, statt Gebrauch von seiner Vernunft zu machen.
Verrat liegt auch vor, wenn der einst enge Weggefährte und Freund Dutschkes Bernd Rabehl, Lehrbeauftragter am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, sich in einem Interview mit der NPD-Zeitung »Deutsche Stimme« zur NPD und zu deren völkisch-nationalistischen Gedanken bekennt. 46Oder schlimmer Verrat ist es auch, wenn Horst Mahler, einst als irrender leninistischer Kader ideologischer Scharfmacher und danach Mitbegründer der RAF, überwechselt auf den rechten Außenrand und Vordenker der »Freien Kameradschaften« und der NPD sowie deren Anwalt wird.
Noch immer hat das Wort »Verrat« einen scharfen Beiklang. Es dient als Totschlagvokabel. Mit einem Wort ist scheinbar alles gesagt. So stellen heute Neonazis wieder »Verräter-Listen« ins Netz. Und noch immer sieht selbst ein Demokrat wie Helmut Kohl, sozialisiert im rauhen Klima des Kalten Krieges an der Hand des groben Überlebensrasters vom Freund-Feind-Denken, gleichsam »Verrat« am Werk, wenn er im Vollzug der Mehrheitsmeinungsbildung demokratischer Kritik an seiner Person ausgesetzt ist. Aber ist es wirklich Verrat, wenn Kohl seinem langjährigen Arbeitsminister Norbert Blüm quasi »Verrat« vorwirft, nur weil der nicht akzeptierte, daß Kohl sein »Ehrenwort« gegenüber anonymen Spendern über Recht und Gesetz stellte? Oder wenn Kohl Richard von Weizsäcker mit dem Geruch des Verräters stigmatisiert, nur weil er als Bundespräsident – der er dank Kohls Hilfe geworden war (Kohl hatte sich seiner Nominierung nicht widersetzt) – das »System Kohl« des »Aussitzens« gegen Ende der achtziger Jahre kritisierte? Kohl über Weizsäcker im zweiten Band seiner »Erinnerungen«: »Richard von Weizsäcker hielt es für notwendig, mich aus dem Amt zu entfernen … Natürlich wagte er es nicht, dies in irgendeiner Form offen zu bekennen … Doch am wärmenden offenen Kamin im Bundespräsidialamt war er Ratgeber für diejenigen, denen es um meinen Sturz ging.« 47Ein normaler demokratischer Vorgang wurde stilisiert zur Verschwörung von »Umstürzlern« 48und von Kohl mit der Kapitelüberschrift versehen: »Gescheiterter Putsch« 49. Natürlich waren Blüm und Weizsäcker keine Verräter. Sie hatten nur Gebrauch gemacht von ihrem Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen.
Читать дальше