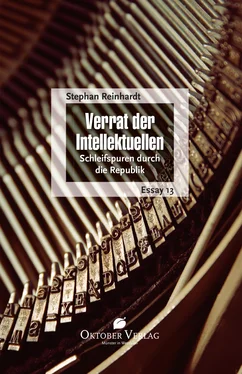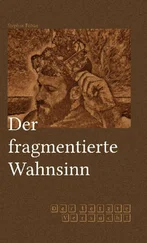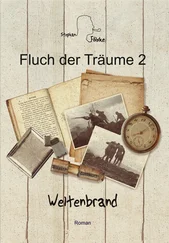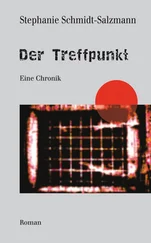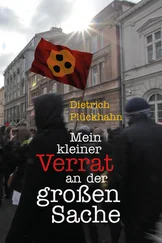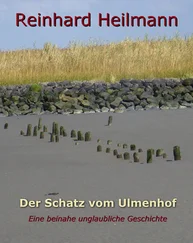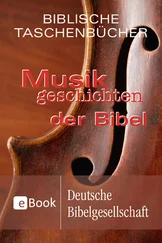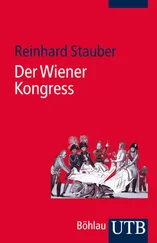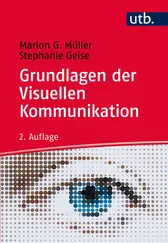Schulterschlüsse zwischen der konservativen, rechtsradikalen Szene und Ernst Jünger stellt auch der »Welt«-Redakteur Heimo Schwilk, Jüngers »Eckermann«, her als Herausgeber der Festschriften zu Jüngers 95. und 100. Geburtstag sowie des Sammelbandes »Die selbstbewußte Nation«. Cantus firmus bildet dabei die kulturkritische Klage über die moderne Zivilisation und ihre vermeintliche Zerstörung transzendierender Sinnstiftung. Jüngers konservative kulturkritische Publizistik der Weimarer Republik wird heute von der Neuen Rechten wiederbelebt.
7. Gegenaufklärung: Botho Strauß‘ »Anschwellender Bocksgesang« I
Den spektakulärsten Schulterschluß mit Jüngers gegenaufklärerischem Weltbild stellte 1993 im »Spiegel« Botho Strauß in seinem »Anschwellenden Bocksgesang« her. Strauß erklärte darin das Zeitalter des »kritischen« (als solches angeblich nur der oberflächlichen Erscheinungswelt verpflichteten) Bewußtseins für beendet und rief mit seinem »Leitbild-Wechsel« eine Trendwende nach rechts aus. Seine nebulöse, keineswegs kristallin klare Wendeformel: »Der, der in den Verbindungen steht, löst den Subversiv-Radikalen, den jakobinisch-›hölderlinischen‹ Zeit-Heros ab.« Unter dem verschwommenen Wort »Verbindungen« versteht Botho Strauß: »Rechts zu sein … von ganzem Wesen, das ist, die Übermacht einer Erinnerung zu erleben; die den Menschen ergreift, weniger die Staatsbürger … Es handelt sich um einen … Akt der Auflehnung gegen die Totalherrschaft der Gegenwart, die dem Individuum jede Anwesenheit von unaufgeklärter Vergangenheit, von geschichtlichem Gewordensein, von mythischer Zeit rauben und ausmerzen will. Anders als die linke … sucht« die rechte »Phantasie« »den Wiederanschluß an die lange Zeit, die unbewegte, ist ihrem Wesen nach Tiefenerinnerung und insofern eine religiöse … Initiation.« 1Nicht alles »Tiefe« ist notwendig religiös initiiert. Auch Aufklärung und Humanität sind »Verbindung«, »Wiederanschluß« und können »Tiefe« haben. Gleichwohl: Strauß vollzieht wie Jünger und dessen Jünger »Tiefenerinnerung« als Aktivierung der Kritik am Emanzipations- und Freiheitsversprechen der Aufklärung, an ihrem, so Strauß, »faulen Befreiungszauber« und am sie weitertragenden Liberalismus, an den »Spöttern, Atheisten und frivolen Insurgenten«. In ihr Recht gesetzt werden müsse dagegen die »Gegenaufklärung« als »Hüter des Unbefragbaren, der Tabus und der Scheu«. Die Agenten des »kritischen Bewußtseins« sind laut Strauß schuld an der gegenwärtigen Krise: An der »Hypokrisie der öffentlichen Moral, die jederzeit tolerierte – wo nicht betrieb –: die Verhöhnung des Eros, die Verhöhnung des Soldaten, die Verhöhnung von Kirche, Tradition und Autorität, sie« dürfen »sich nicht wundern, wenn die Worte in der Not kein Gewicht mehr haben.« 2Soldat, Kirche, Tradition, Autorität – Straußens Argumentationskette, die in der Prophezeiung »Es wird Krieg geben« mündet, läßt sich in Jüngers Wort- und Wertewelt ebenso nahtlos einfügen wie sich Karl Heinz Bohrers Ruf nach militärischer »Härte und Entschlossenheit« aus ihr ableiten läßt – oder Bohrers Klage über die »saturierte Gemeinschaft« von bloßen »Konsumenten«, feige und risikounwillig gemacht durch bloße Händler- und »Sozialhelfermentalität«. Aber ist das brillant, Sozialhelfer (in den achtziger Jahren ein beliebtes Spottobjekt auch der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«) zu diskriminieren als »Händler« und »Krämer«? Was denn ist an einem Sozialhelfer der Krämer? Und damit sich Patriotismus und Gemeinsinn besser entfalten können, darf es auch im Sinne von Karl Heinz Bohrer ab und zu auch wieder Krieg geben. Schon während des Falklandkrieges 1982 ergoß Bohrer in der »FAZ« mit Vorliebe Spottkübel auf die in seinen Augen provinzielle, jedes Risiko scheuende »Händlergesinnung« der Bundesdeutschen. Er verkaufte sich clever als frecher Kulturkritiker. Und empfahl als Remedium: »Die nationale Identität als das große Über-Ich, ja sogar das mystische Element der Ehre – auf einen Begriff gebracht: Spiritualität« 3. Mit Lust an provokativer Polemik beklagte der spirituelle »nationalen Identitäts«- und »Ehren«-Protége – dulce et decorum est pro patria mori – die »notorische Fettästhetik« und das mangelnde nationale Selbstbewußtsein des in der Bundesrepublik in seinen Augen zur Macht gelangten Mittel- und Kleinbürgerstandes. Ein von »Ängstlichen« und »Kleinkarierten« bewohntes Land – so borgte sich der Ernst Jünger-Experte Jüngers (wohlfeile, demokratie-defizitäre) Bürger-, Klein- und Spießbürger-Schelte aus –, »dem nur an Geschäft und Rendite liege und jeder Wille zur Selbstbehauptung, zu militärischer Einsatzbereitschaft« fehle: »Es gibt keine Nation auf Erden, nicht einmal die sprichwörtlichen Levantiner, die so ausschließlich von ökonomischen Argumenten beherrscht wären wie die Westdeutschen. Sie sind die neuen Phönizier, das heißt, sie erkaufen sich alles, selbst den russischen Frieden, so wie die karthagischen Kaufleute selbst nicht gegen die Römer kämpften, sondern Söldnerheere schickten. Die westdeutsche Händlergesinnung enthält im Unterschied zu Karthago allerdings kein Staatsbewußtsein mehr, keine Staatssymbolik, sondern bloß das harmlose Bild föderativer, fettprangender Provinzen zwischen Karneval und Weinernten. Mit Metzgereien ausstaffiert wie mit Boutiquen und so übersättigt, verängstigt, eingekauft ist diese westdeutsche Händlernation, daß sie nur andere für sich kämpfen lassen könnte, oder es bräche eine Massenhysterie aus … Da sie das nicht offen zugeben kann, tabuisiert sie den Kampf überhaupt oder rationalisiert sie ihre Angst davor mit pragmatischer Vernunft, das heißt mit wirtschaftlichen Zwängen wie der Ertragslage der Schiffbauindustrie oder Erdgasgeschäften. Wie verräterisch! Alles geht, denn alles beweist das Ende aller Kriege im Zeichen der händlerischen Vernunft.« 4
Bloße »Händlergesinnung«, die feige das Sichbehaupten in Kampf und Krieg verlernt habe und deshalb tabuisiere – fast bis in die Wortwahl hinein folgte Bohrer mit solch säbelrassender geistiger Aufrüstung und Kriegerei seinem Männlichkeitsidol Ernst Jünger. Und schlug zugleich als intellektueller Netzwerker die Brücke zum reaktionären Theorieorgan »Junge Freiheit«, zu Filbingers »Studienzentrum Weikersheim«, zu im »Coburger Konvent« organisierten nationalen Studentenverbindungen. Und auch zu Manfred Pohls, Hans-Olaf Henkels, Roland Bergers »Konvent für Deutschland«. Bohrer den Heinrich-Mann-Preis zu verleihen, wie es 2007 geschah, ist so, als erhielte Präsident Bush oder dessen Gedichte verfassender Justizminister John Ashcroft den Friedensnobelpreis.
8. Journalistenbeschimpfung als Sündenbocksuche
Als Ausgeburt und Inbegriff des Krämergeistes und »händlerischer Vernunft« werden heute mit Vorliebe diskriminiert Jüngers »Schreiberlinge«, die Vertreter der »vierten« Gewalt der Demokratie: Journalisten. Karl Heinz Bohrer: »Wenn diese händlerische Vernunft in den seriösen Medien so überdimensioniert widergespiegelt ist, dann liegt das auch an der Psyche eines Berufsstandes: Journalisten, liberal, wie sie mehrheitlich sind, haben die händlerische Vernunft mit Löffeln gefressen. Opportunistisch und voyeuristisch, verstehen sie nicht die Symbole des Ernstfalls. Letztlich Unbeteiligte, verwandeln sie den Ernstfall immer in einen Verhandlungsfall und diesen dann in einen moralisch-modernen Vorwurf gegen solche, die den Ernstfall begriffen und akzeptiert haben.« 1Breit gemacht habe sich im westdeutschen Medien- und Kulturbetrieb, so Bohrer, das »Gelabere«: »Sein verräterisches Wort heißt ›Vermittlung‹. Dadurch ist die schwierige intellektuelle und politische Opposition, ist der Konflikt geistig aufgehoben, alles ist auf dem Wege, sozusagen im Prozeß, und wenn das nicht hilft, dann hilft immer der furchterregende, weil tabuschüttelnde Hinweis auf das durch Carl Schmitt ein für allemal angeblich desavouierte ›Freund-Feind-Denken‹.« 2Bohrer unterschlägt, daß Wörter wie »Vermittlung« und »Kompromiß« Wesenselemente demokratischer Prozeduren sind, und er revitalisiert Carl Schmitts undemokratisches Freund-Feind-Denken. »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« – mit dieser griffigen Grobformel reduzierte Carl Schmitt, Jüngers langjähriger Briefpartner und ideologischer Mitstreiter, in seiner »Politischen Theologie« von 1922 alles Politische auf ein existentielles Freund-Feind-Verhältnis – eine gedankliche Militarisierung, mit der der ›Kronjurist‹ des »Dritten Reiches« bereits in den Zwanziger Jahren das ideelle Geschäft der Nazis betrieb. Nicht um Abbau, sondern um Steigerung des Intensitätsgrades von Konflikten ging es damit Schmitt und Jünger, um Freisetzung national-revolutionärer Energie – vom »Schicksal«, von der Geschichte zugespielt.
Читать дальше