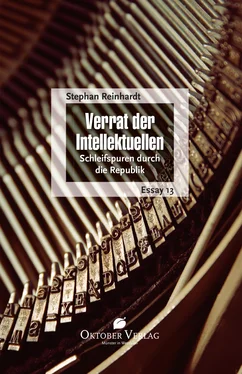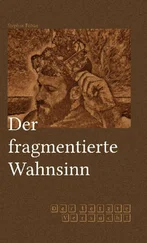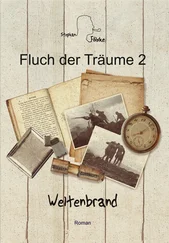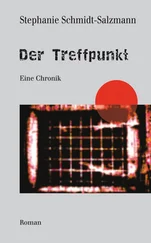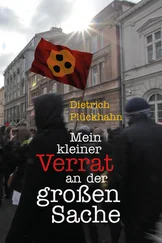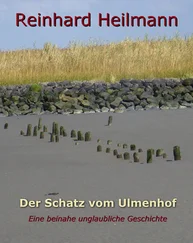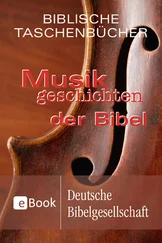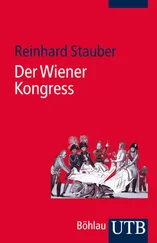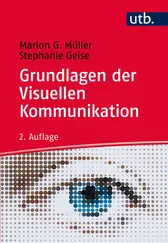Jünger folgte damit dem deutschen Sonderweg, jenem Irrweg, der die Menschenrechtsuniversalien der Aufklärung verachtete. Am eindeutigsten formulierte er 1929 im Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband »Der Kampf um das Reich« den deutschen Abweg: »Der späte Liberalismus, der Parlamentarismus, die Demokratie als Herrschaft der Zahl, ein geistiges Franzosentum und ein Europäertum, dessen Metaphysik die des Speisewagens ist, ein Amerikanismus mit der Gleichsetzung von Fortschritt und Komfort … – dieses ganze Gewirr von überalterten und überfremdeten Dingen gleicht einem dichten Telefonnetz, zu dem das deutsche keinen Anschluß hat.« 32Anschluß fand das deutsche Telefon Ernst Jüngers ausschließlich beim »Horchen auf die geheime Ursprache des Volkes«. Allein das, so Jünger, gewährte »sichere Zuflucht zum mütterlichen Sein«, zum Elementaren. Als undeutsch, weil bloße, zu universellen Prinzipien erklärte Abstraktionen galten Leitwerte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Undeutsch war es dabei auch, den Staat zu verstehen als notwendige Organisation zum Schutze der Menschenrechte, deutsch dagegen, dem ständestaatlich organisierten und autoritär geführten Staat die Qualität eines lebendigen Organismus zuzuschreiben. Volk und Nation der Deutschen waren so das Maß aller Dinge. Ihm hatte sich der einzelne total unterzuordnen. Geht es biologistischer, kriegerischer, kämpferischer und totalitärer als bei Jünger? All das ist in Karl Heinz Bohrers Lesart seiner künstlich konstruierten – und im Grunde nichtssagenden – Kategorie der Plötzlichkeit ohne Bedeutung.
3. Gottfried Benn: »Ich erkläre mich ganz persönlich für den neuen Staat, weil es mein Volk ist, das sich hier seinen Weg bahnt«
Der deutsche Sonderweg – ein Irrweg für ganze Generationen und ihre geistigen Eliten. Für den national erglühten Berufssoldaten Ernst Jünger ebenso wie für den skeptischen Arzt Gottfried Benn. Im »Horchen auf die geheime Ursprache des Volkes« schloß Benn sich – 1930 im Libretto für Paul Hindemiths Oper »Der Unaufhörliche« – an das Existential des »Unaufhörlichen«, das heißt des ewigen Auf und Ab der Geschichte, des Blühens und Vergehens von Kulturen, das biologisch und historisch als Schicksal verhängt zu sein scheint. Kulturen, so codiert Benn, ›vollziehen‹ sich unabhängig von Menschen. Was Menschen also denken, tun, politisch wollen, ist unerheblich. Bestätigung für diesen fatalistischen Determinismus-Code fand Benn in Oswald Spenglers rechtem Kultbuch »Untergang des Abendlandes«. Durch Spenglers eklektizistisches Handbuch des Konservativismus sah sich Benn darin weithin bestätigt: Die westliche Demokratie, der ihr zugrundeliegende Individualismus, das Menschenrechtsdenken der Aufklärung – waren sie nicht Ausdruck eines allgemeinen Verfalls, der nur durch den »Gang zu den Müttern« zu überwinden war? Spenglers großer Erfolg, der erste Band erschien im letzten Kriegsjahr 1918, rührte daher, daß die deutsche Niederlage mit dem Untergang des Abendlandes verklärt werden konnte. Auch Benn traf mit seinem apolitischen Geschichtspessimismus und seiner Verfalls- und Untergangsmelancholie die Lebensstimmung derer, die der schlechte Kriegsausgang enttäuscht hatte. Den ideologischen Kern von Benns Libretto »Der Unaufhörliche« lobte die »Berliner Börsen Zeitung« nach der Uraufführung im September 1931 ausdrücklich: Benn, dieser Mann »aus dem Blute der Mystiker«, ließ Peter Hamecher verlauten, wolle mit seiner Rationalismuskritik dem Leben durch »Hereinnahme des Irrationalen« endlich »wieder Weite geben und Sinn« 1. Der Komponist Robert Oboussier dagegen wies in der »Frankfurter Zeitung« auf den Widerspruch hin, in den Benn sich verstrickte, wenn er das »Unaufhörliche« zum universellen Prinzip erhob. Was denn genau, fragte Oboussier, bezwecke Benn mit diesem »Unaufhörlichen«, wenn er doch auf dem Hintergrund seines Nihilismus das Ringen des Menschen mit ihm als religiöses oder philosophisches Prinzip wiederum für sinnlos erkläre? Herausgekommen sei daher nicht mehr als ein »klagendes Lied vom Katzenjammer der vom Daseinsapparat eingestampften Menschen« 2. Das »Unaufhörliche« war die – ja ebenso auch von Heidegger philosophisch betriebene – Rechtfertigung dessen, was geschah, was sich geschichtlich ereignete, also auch der völkischen, nationalen »Bewegung«. Solche Verweigerung von Aufklärung und politischem Gestaltungswillen wurde gedankliches Allgemeingut; es erhielt im Laufe der Weimarer Republik immer mehr Beifall aus der Mitte der Gesellschaft.
Als Gottfried Benn Heinrich Mann 1931 zum 60. Geburtstag auf dem Bankett des »Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller« mit einer Rede ehrte, lobte er den Artisten und Ästheten, würdigte den politischen Ziehvater von Republik und Demokratie jedoch mit keinem Wort. Den Architekten Werner Hegemann verleitete das zu der Feststellung: Benn rutsche immer weiter ins faschistische Lager ab, seine Kunsttheorie sei »im Geiste Hitlers« 3empfunden. Und es war – vorübergend – auch so: Als Benn am 9. Januar 1932 in die »Section Dichtkunst« der Preußischen Akademie der Künste gewählt wurde, empfand er Genugtuung. Wurde ihm nicht endlich jene Anerkennung zuteil, die ihm schon lange gebührte? In seiner »Akademie«-Rede am 5. April 1932 skizzierte er – sich der Theorie des Wiener Neurologen Konstantin von Economo bedienend – in Gegenwart der sichtlich irritierten Brüder Heinrich und Thomas Mann sein für einen Mediziner erstaunlich irrationalistisches Weltbild: Die »progressive Zerebration«, »die unaufhaltsam fortschreitende Verhirnung der menschlichen Rasse«, ideologisierte er, führe zur »Frigidisierung des Ich« 4. Die Überspezialisierung des Leitorgans Gehirn bedeute den Untergangs der Gattung Mensch, sofern dem nicht, stellte er ganz im Sinne Nietzsches und Spenglers dar, ein neuer Menschentyp entgegenarbeite: der »höhere«, »tragisch kämpfende Mensch«. In seiner »Nach dem Nihilismus« überschriebenen Einleitung des gleichnamigen Essaybandes von 1932 beschrieb Benn das zur Überwindung der Misere notwendige »Gesetz« des »Willens zur Macht« bereits mit unmißverständlich faschistischem Vokabular: »Es bekäme dann für ihn den Charakter einer volkhaften Verpflichtung, kämpfend, den Kampf seines Lebens kämpfend, sich an die eigentlich unerkämpfbaren Dinge heranzuarbeiten, deren Besitz älteren und glücklicheren Völkern schon in ihrer Jugend aus ihren Anlagen, ihren Grenzen, ihren Himmeln und Meeren unerkämpft erwuchs: Raumgefühl, Proportion, Realisierungszauber, Bindung an einen Stil.« 5
Auch Benn beeindruckten am 30. Januar 1933 die nächtlichen Fackelzüge der »nationalen Erhebung«. »Schicksalsrausch« ergriff von ihm wie von Millionen »Volksgenossen« Besitz, er sah sich als Teil des »mythischen Kollektivs« und glaubte an die Erneuerung des deutschen Volkes, an einen rassisch-völkischen Ausweg aus all dem, was er für fatal hielt: Aufklärung, Rationalismus, Funktionalismus und kapitalistische Selbstbereicherung. Eilfertig formulierte er, nach Heinrich Manns Rücktritt als Präsident selbst kommissarischer Vorsitzender der Preußischen Akademie, eine Loyalitätserklärung. Sie wurde auch an die vor und nach dem Reichstagsbrand geflüchteten Akademiemitglieder geschickt: »Sind Sie bereit, unter Anerkennung der veränderten geschichtlichen Lage weiter Ihre Person der Preußischen Akademie der Künste zur Verfügung zu stellen? Eine Bejahung dieser Frage schließt die öffentliche politische Betätigung gegen die Regierung aus und verpflichtet Sie zu einer loyalen Mitarbeit an den satzungsgemäß der Akademie zufallenden nationalen kulturellen Aufgaben im Sinne der veränderten geschichtlichen Lage.« 6Benn war zu mehr als loyaler Mitarbeit bereit. Vor dem Mikrophon des Berliner Rundfunks bekannte er sich vier Wochen nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes, am 24. April 1933, öffentlich zum NS-Regime. Alles, begann Benn seine »Der neue Staat und die Intellektuellen« programmatisch überschriebene Rede, was sich in der Weimarer Republik zu den Intellektuellen zählte, habe das Entstehen des NS-Staates bekämpft und begeistert »jeden revolutionären Stoß von Seiten des Marxismus« begrüßt. Heute jedoch habe weder der Internationalismus Schillers noch der der Sozialisten gesiegt, sondern die »nationale Revolution«. Anfällig für sakrales Pathos, trug Benn feierlich auf: »Eine echte neue geschichtliche Bewegung ist vorhanden, ihr Ausdruck, ihre Sprache, ihr Recht beginnt sich zu entfalten, sie ist typologisch weder gut noch böse, sie beginnt ihr Sein … und es tritt ein in ihr Sein die Diffamierung von Seiten aller sich zu Ende neigender Geschlechter, die Kultur ist bedroht, die Ideale sind bedroht, das Recht, die Menschheit ist bedroht, es klingt wie Echo; aus der Lombardei, aus Ungarn, aus Versailles, als die Gallier kamen, die Goten, die Sansculotten, klang es schon so. Sie beginnt ihr Sein, und alles Feine, Abgestimmte, zu was Gelangte wirft sich ihr entgegen; aber es ist die Geschichte selber, die diese Angriffe entkräftet, ihr Wesen, das nicht abgestimmt undemokratisch verfährt. Die Geschichte verfährt nicht demokratisch, sondern elementar, an ihren Wendepunkten immer elementar. Sie läßt nicht abstimmen, sondern sie schickt den neuen biologischen Typ vor, sie hat keine andere Methode, hier ist er, nun handele und leide, baue die Idee seiner Generation und deiner Art in den Stoff der Zeit, weiche nicht, handele und leide, wie das Gesetz des Lebens es befiehlt.« 7
Читать дальше