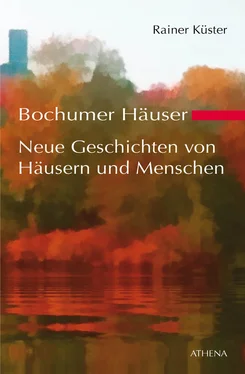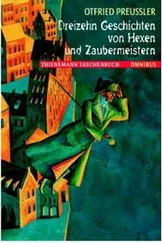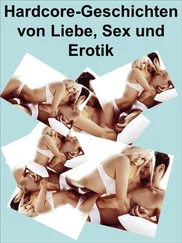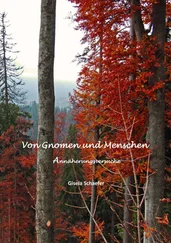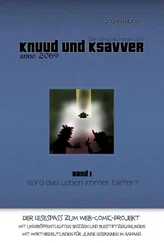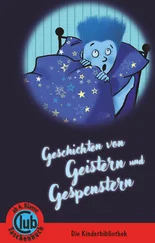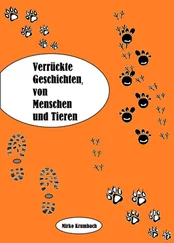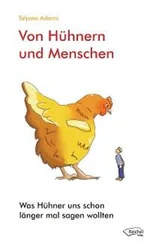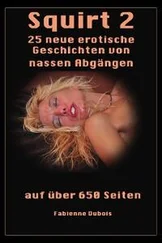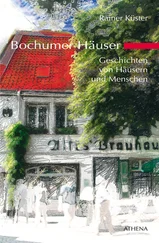Die war mitten in der Kolonie, die Straße. Das war ja eine reine Aschenstraße, da haben wir natürlich auch Fußball gespielt. Aber wir hatten keinen richtigen Ball, sondern irgendwas Zusammengebasteltes aus Stoff; das Ding war zwar weich, flog aber nicht weit, Gott sei Dank. Man durfte ja auch nicht hinfallen. Wenn es doch passierte, dann führte das zu bösen Verletzungen.
Für drei Jungen, Heinz Esken, Paul Vierhok und Heinz Brandau, die in der Kolonie eine verschworene Gemeinschaft bildeten, gab es noch andere Spielplätze. Das Grabeland reichte etwa bis zum Fußgängertunnel, der heute unter dem Ruhrschnellweg hindurch von der Matthias-Claudius-Straße zur Josephinenstraße führt. Da hatte jeder sein Stückchen, da war nichts eingezäunt, sondern die Bergleute aus der Kolonie bauten alle ihre Kartoffeln an und manchmal auch ein paar Bohnen. Dahin wurde auch das, was sich in der Aalkuhle angesammelt hatte, transportiert. Irgendeiner der Nachbarn hatte eine Karre mit einem runden Behälter drauf; in diesen Behälter wurde der ganze Schlamassel hineingeschöpft, dann die Straße entlang geschoben und auf dem Acker verteilt. Aber für die drei Jungen war wichtig, was jenseits lag, denn hinter dem Grabeland gab es ein wildes Feld, und mitten auf dem Feld stand eine Ziegelei, umgeben von Lehmbergen, die dort abgebaut wurden. Das war eine Spielecke, von der die Kinder glaubten, dass sie in die Zeit passte. Wo man sich in den Lehmbergen vergraben, sich vor dem Feind verbarrikadieren, Unterstände bauen konnte.
Damals war das ja bei Jungen so üblich. So wurden wir auch erzogen. Wir haben da alle ein bisschen Krieg gespielt, im Dritten Reich.
Ernster wurde die Sache schon beim Jungvolk. In der NS-Zeit wurden Jungen und Mädchen vom neunten oder zehnten Lebensjahr an uniformiert. Das machte anfangs sogar Spaß. Exerzieren und sportliche Übungen waren an der Tagesordnung. Die Aufmärsche und Versammlungen fanden nebenan auf dem Schulhof statt, wo sich auch die Hitlerjugend traf. Heinz Esken war beim Jungvolk zum Jungenschaftsführer ernannt worden, trug eine rot-weiße Kordel und durfte eine kleinere Gruppe kommandieren. Da er von einem Nachbarjungen gelernt hatte, mit dem Kleinkalibergewehr zu schießen, bewies er auch beim Jungvolk in dieser Sparte eine große Treffsicherheit. Er wurde gefördert und errang als erster Pimpf in Bochum das »Jungvolk-Schießabzeichen«. Heinz war stolz, denn die Zeremonie, in der ihm die Nadel mit dem Abzeichen an die Brust gesteckt wurde, fand auf dem Sportplatz an der Castroper Straße statt, und der gesamte Bann Bochum mit Jungvolk und Hitlerjugend war angetreten.
»Die Schule, zu der du gegangen bist, war die nebenan? Dieselbe, auf der ihr auch exerzieren musstet?«
Nein, erst als die Zusammenlegung kam, als die Konfessionsschulen wegfielen. Wir waren katholisch, und ich besuchte zunächst die Schule an der Ecke Rottmannstraße/Ruhrschnellweg. Das ist etwa da, wo heute die Hauptschule am Lenneplatz steht. Woran ich mich erinnere, ist, dass zwischen Lenneplatz und Ruhrschnellweg eine Müllkippe war. Da wurde gekippt, und wir Schüler wurden direkt nebenan in einem alten, verkommenen Schulgebäude unterrichtet. Als i-Männchen saß ich in einer Doppelbaracke. Dahin sind wir am ersten Tag noch von den Müttern begleitet worden. Und dann hieß es nur noch: ›Lauf mal!‹ Da war ja noch nicht so viel Verkehr auf dem Ruhrschnellweg, der war damals noch dreispurig. Jede Fahrtrichtung eine Spur, und auf der mittleren Spur konnte man von beiden Seiten aus überholen.
»Und da musstest du rüber, über den Ruhrschnellweg?«
Ja, sicher. Ich bin also die Castroper Straße ein Stück raufgegangen, und dann in die Rottmannstraße rein, wo heute noch der Friseur Ungetüm ist – das ist immer noch derselbe Name, wo mir immer ein Kurzhaarschnitt verpasst wurde, mit schrägem Scheitel natürlich – und dann über den Ruhrschnellweg. Das war mein Schulweg.
Heute ist diese Schule samt angrenzender Müllkippe vom Erdboden verschwunden. Der ganze Bereich ist nach dem Kriege siedlungsmäßig bebaut worden, bis hinüber zum Gewerbegebiet. Im Jahre 1939 kam Heinz Esken dann auf die Schule neben seinem Elternhaus. Nach der Zusammenlegung gab es keine Konfessionsschulen mehr. Das war für ihn sehr bequem; er brauchte nur über die Straße zu laufen. Stolz war man, weil die Schule inzwischen auch einen Namen bekommen hatte. Bis dahin gab es viele namenlose Schulen. Nun hieß man plötzlich »Kaiser-Otto-Schule«.
Die Schulmauer war niedrig. Da konnte die Mutter dem Jungen jeden Morgen sein Bütterken rüberbringen. Und weil er so ein schlechter Esser war, stand sie an der Mauer und rief: »Junge, iss doch!«, aber er kriegte nichts runter. Geleitet wurde die Schule vom Rektor Aufderheide, einem strengen Mann, der auch den elfjährigen Heinz Esken unterrichtete. Der Rektor besaß einen kleinen Stock, der ihm zu pädagogischen Zwecken diente, denn je nach Maßgabe der Unbotmäßigkeit verpasste er damit seinen Zöglingen entsprechende Schläge in die Hände. Heinz bekam den Stock zu spüren, als er einen Nachbarn abschreiben ließ.
Spielen durfte man nicht auf dem Schulhof. Der Hausmeister sorgte dafür, dass dieser Ort der Hitlerjugend vorbehalten blieb. Und bald wurde ohnehin Ernst aus dem Spiel. Seit dem 1. September 1939 war Krieg. Das bekam man auch im Ruhrgebiet zu spüren. Zum ersten Mal wurde das Ruhrgebiet im Jahre 1940 von der britischen Luftwaffe bombardiert. Vom Mai 1941 an fielen auch in Bochum die Bomben, zunächst aber noch nicht an der Castroper Straße. Doch das war nur eine Frage der Zeit, und die Fliegerangriffe würden nicht mehr aufhören bis zum bitteren Ende. Vater Esken war als Bergmann vom Kriegsdienst freigestellt worden. Wer in kriegswichtiger Position (Bergleute, Stahlarbeiter, Bauern) tätig war, wurde bis zum Jahr 1943 nicht einberufen.
Auch der junge Heinz Esken machte seine Erfahrungen mit der neuen Situation. Einen Bruder des Vaters hatte es nach Ortelsburg in Ostpreußen verschlagen, heute heißt der Ort Szczytno und liegt im masurischen Seengebiet. Dieser Bruder war zum Kriegsdienst eingezogen worden und besuchte, wie es sich gehörte, in Uniform die Familie Esken in Bochum. Es war Sommer, die Familie ging im Stadtpark spazieren. Der Onkel hatte aufgrund der großen Hitze den obersten Knopf seiner Uniform geöffnet. Daraufhin wurde er von einem Offizier angeschnauzt, musste stramme Haltung annehmen und natürlich den Uniformknopf wieder schließen. Ein deutscher Soldat hatte sich ordentlich zu kleiden. Der Junge verstand nicht, was das sollte.
Der Onkel wurde später an der Ostfront eingesetzt, zuletzt vor Leningrad. Eines Tages wurde die Wohnung an der Castroper Straße gestürmt, vom Ortspolizisten, der sich zu diesem Zweck extra seinen Tschako aufgesetzt hatte, und von einigen Herren in Zivil. Man sperrte die Familie Esken in der Küche ein und durchsuchte die gesamte Wohnung, den Keller, das Dachgeschoss und schließlich auch noch den Stall, ohne dass etwas dabei herauskam. Den Grund nannte man der Familie erst am Schluss: Der Onkel war fahnenflüchtig. Später traf ein Brief des Onkels ein, seine letzten Zeilen. Man hatte ihn gefasst. Als der Brief in der Castroper Straße abgegeben wurde, hatte man den Onkel schon erschossen. Mutter Esken musste der Witwe einen Ariernachweis besorgen, damit sie, nun auf sich allein gestellt, Arbeit bekam.
Der Vater wurde nicht mehr eingezogen. Aber man kann in diesem Fall wohl nicht von Glück sprechen. Im April 1942 ereilte ihn das Schicksal unter Tage. Auslaufende Kohle, so hieß die lakonische Erklärung. Auf der Zeche Amalia. Seinem Jungen erklärte man später, der Vater sei von der abrutschenden Kohle eingeklemmt worden, so dass er sich nicht mehr habe retten, sich nicht mehr habe mitlaufend befreien können. Er war in der auslaufenden Kohle erstickt. Die Nachbarn hörten es eher als die Familie. Die heimkehrenden Kollegen wussten, Heinrich Esken war verschüttet. Ihnen war klar, was das bedeutete. Aber der Junge saß in der Küche der Bergmannswohnung und hoffte noch auf ein Wunder, betete. Aufgebahrt wurden die toten Bergleute damals auf der Zeche. Das war so üblich. Anschließend kam die Beerdigung in der Trauerhalle am Freigrafendamm. Das Bergmannsorchester spielte »Ich hatt ’ einen Kameraden …«.
Читать дальше