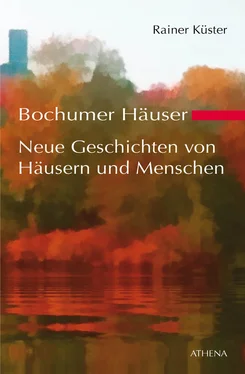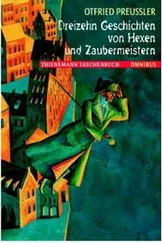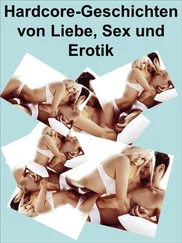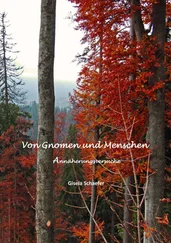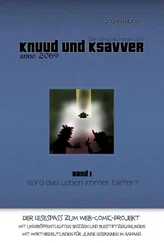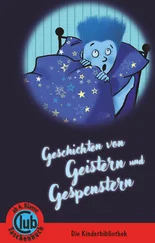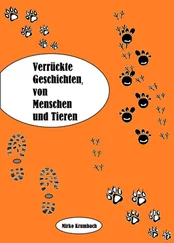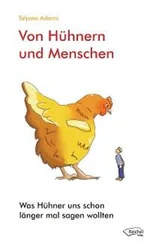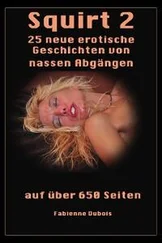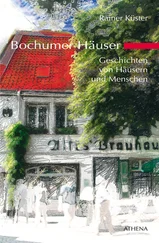Wer vor dem Gebäude des Kulturrats steht und sich umsieht, spürt trotz einiger Modernisierungen, die im Eingangsbereich vorgenommen wurden, dass er sich hier gewissermaßen auf historischem Boden, in einem Restensemble von Industriearchitektur aus der Jahrhundertwende befindet. Auf der Schachtanlage Lothringen, in deren ehemaligem Magazin heute Kultur gemacht wird, wurde knapp neunzig Jahre lang Kohle gefördert. Die Anlage zählte eher zu den jüngeren Zechengründungen. Im Jahre 1880 war die Förderung aufgenommen worden. Zu jeder Zeche gehörte als unverzichtbare Einrichtung ein Magazin, also ein Lager für alle möglichen Dinge, die der Kumpel untertage brauchte, vom Nagel und Hammer über die Arbeitskleidung bis zum Gezähe. Es gab einen Magazinverwalter, und die Ausgabestelle des Magazins musste gewöhnlich Tag und Nacht besetzt sein, so dass sich die Bergleute jederzeit die für sie nötigen Utensilien abholen konnten. Dafür brauchten sie einen Bezugsschein, der zuvor vom Steiger unterschrieben wurde. Das System muss trotz oder auch wegen dieser Bezugsscheine gut funktioniert haben, denn unter Bergleuten erzählt man sich, dass ein umsichtiger Kumpel immer eine gut sortierte Auswahl an Nägeln im Hause hatte.
Bis 1913 wurden auf der Zeche Lothringen insgesamt fünf Schächte abgeteuft. Im Jahre 1912, also exakt vor hundert Jahren, erlangte die Anlage traurige Berühmtheit, denn bei einer schweren Schlagwetterexplosion auf Lothringen 1/2 starben 112 Bergleute. Kaiser Wilhelm II., der sich damals gerade zur Jahrhundertfeier der Firma Krupp in Essen aufhielt, besuchte höchstpersönlich die Unglückszeche.
Am 1. August 1929 wurde Gerthe nach Bochum eingemeindet. Die Zeche Lothringen war nun auch eine Bochumer Zeche, gehörte ins Kohlengräberland. Bochum war 1929 die zechenreichste Stadt auf dem Kontinent und hatte nach den vielen Eingemeindungen im Nordosten nun auch gemeinsame Grenzen mit Herne, Castrop-Rauxel und Dortmund.
Dann kam die Nazizeit, und ein paar Jahre später kam der Krieg. Im Gewerbegebiet an der Gewerkenstraße, im nordöstlichen Teil von Gerthe, und zwar direkt bei der Schachtanlage III, wurde während des Zweiten Weltkriegs das Zwangsarbeiterlager Zeche Lothringen errichtet, um den erforderlichen Bedarf an Arbeitskräften zu sichern. Wenn man auf den Stadtplan guckt, erkennt man, dass dieses Lager nur etwa tausend Meter vom Magazingebäude der Zeche entfernt lag.
Heute erinnern neun von ursprünglich elf Baracken an das Lager, in dem im Sommer 1943 einhundert Zwangsarbeiter und über dreihundert sowjetische Kriegsgefangene untergebracht waren. Auch in Gerthe galt, was im gesamten Ruhrbergbau praktiziert wurde: Seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Belegschaften Schritt für Schritt durch ausländische Arbeitskräfte ergänzt. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann in der Gerther Zeche wie in den anderen Bergwerken des Ruhrreviers der Masseneinsatz sowjetischer Kriegsgefangener unter unmenschlichen Bedingungen. Zwischen Januar 1942 und Mitte 1944 wurden rund 215.000 sogenannte Ostarbeiter und Kriegsgefangene in die Zechenlager deportiert. Ihr Anteil an den Belegschaften betrug nun fast 40 Prozent.
Zur Unterbringung wurden in der Regel Barackenlager errichtet. Das Lager der Schachtanlage III entstand als eine von vier vergleichbaren Einrichtungen der Zeche Lothringen. Die Baracken gruppierten sich um zwei ältere Backsteingebäude: die Elektrozentrale und die Waschkaue. Nach dem Krieg wurden die Baracken in kleinere Wohneinheiten aufgeteilt. Zunächst wurden sie als Notunterkünfte für Ausgebombte und angeworbene Bergleute genutzt. Später lebten hier Gastarbeiter aus der Türkei, Italien und Griechenland.
In den achtziger Jahren wurde auf dem Areal ein studentisches Wohnprojekt entwickelt, das die Gebäude mehr oder weniger in den heutigen Zustand versetzte, und zwar – wie es in dem entsprechenden Wikipedia-Eintrag heißt – ohne Wissen um die Geschichte des Lagers. Später kamen andere Mieter, die wussten, wo sie waren, und die sich energisch für den Erhalt der Siedlung einsetzten. Trotz aller Umbauten scheint die Grundstruktur des Lagers heute noch weitgehend bewahrt; das Gerther Barackenlager kann damit als eines der wenigen vorhandenen Beispiele seiner Art in Deutschland gelten.
Wenn man die Anlage besucht und mit einigen der Anwohner spricht und die Kinder auf den Rasenflächen spielen sieht, hat man den Eindruck einer kleinen Insel der Seligen. Natürlich mussten, um hier dauerhaft leben zu können, die vergifteten Böden saniert, die Holzbaracken weiterhin renoviert werden. Sogar zwei Bunker, die vermutlich von den Zwangsarbeitern selbst angelegt worden waren, hat man im Zuge der Sanierungsmaßnahmen unter dem Gelände entdeckt. Dem mehrmals drohenden Abriss durch die Ruhrkohle AG, die alle Bewohner liebend gern umgesiedelt hätte, entging das Lager aufgrund vielfältiger Initiativen und Anstrengungen der heute dort lebenden Menschen, die gegenüber den politischen Gremien, die involviert waren, auch auf die komplexe historische Bedeutung der Wohnanlage verweisen konnten. Das glückliche Ende kam, als das ehemalige Zwangsarbeiterlager der Zeche Lothringen mit Hilfe des Bochumer Ratsmitglieds Dr. Hans Hanke im August 2005 in die Denkmalliste eingetragen wurde.
Was die Zeche selbst betraf, so war hier in den achtziger Jahren längst Schicht im Schacht. Im Jahre 1964 waren auf Lothringen im Verbund mit der Zeche Graf Schwerin in Castrop-Rauxel noch 1,6 Millionen Tonnen Kohle gefördert worden; doch nur kurze Zeit später kam das Ende. Schuld war die Krise im westdeutschen Steinkohlebergbau, die dazu führte, dass im Jahre 1967 die Gesamtanlage stillgelegt wurde. Das ist nun auch schon wieder 45 Jahre her. Aber zum Glück gibt es immer Leute, die nicht nur ein paar Ideen haben, was man mit den unterschiedlichen Restbeständen einer Industriearchitektur, die es so nie wieder geben wird, anfangen könnte, sondern die auch die Kraft haben, ihre Vorstellungen durch- und umzusetzen.
Und damit zurück zu dem Künstler Gölzenleuchter, der in dem alten Magazinhaus eine kongeniale Arbeitsstätte gefunden hat. An Werktagen reist er, aus Querenburg kommend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Hier arbeitet er, empfängt Besucher, führt Workshops für angehende Künstler durch, erklärt im Rahmen von Führungen seine Arbeit, betreut Gruppen von Kindern, die die Kunst für sich entdecken wollen.
Wie alles anfing, möchte ich wissen. Geboren ist er 1944 in Freiburg. In Dahl bei Hagen lebte die Familie nach dem Krieg, dort gab es beim Friseur die Zweigroschenhefte, Sigurd, Akim, Silberpfeil – hier schon die wechselseitige Erhellung von Wort und Bild –, die es dem Jungen angetan hatten. Später, als die Familie nach Bochum übergesiedelt war, kamen die Landserhefte hinzu. Auch hier wieder Worte (manchmal auch nur Wörter) und Bilder, und zwar der ganz besonderen Art: Der deutsche Held im Zweiten Weltkrieg, Geschichten vom ehrlichen Kämpfer an der Front, das waren die Themen und auch die Botschaften. Neben den deutschen Soldaten gab es noch ganz andere Helden: Aus der Leihbücherei in der Brückstraße holte er sich Tom Prox und andere Wildwestgrößen ins Haus oder unter die Bettdecke.
In diese Zeit reicht auch die Geburt des Namens Oskar zurück, der sich bis heute gehalten hat. Kreiert, weil benötigt, wurde er auf dem Fußballplatz. Da müssen die Namen kurz sein. Horst Dieter war zu lang, Gölzenleuchter noch länger. Hinzu kam, dass sich der Junge einen Igelschnitt, die damals beliebte Meckifrisur, zugelegt hatte. Nun sah er aus wie der österreichische Filmschauspieler Oskar Sima, der in den Filmkomödien der fünfziger Jahre gern die zwielichtigen Typen spielen durfte. Inwieweit die Wahl dieses Spitznamens Oskars Fußballspiel kommentierte, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall brauchte man auch auf dem Fußballplatz, der wohl eher ein Bolzplatz gewesen sein dürfte, ein paar Helden.
Читать дальше