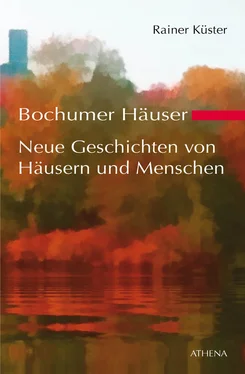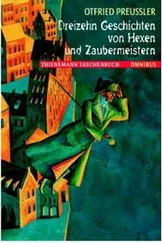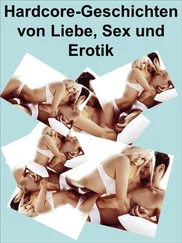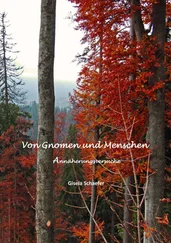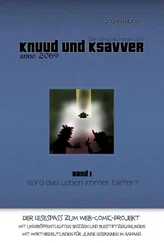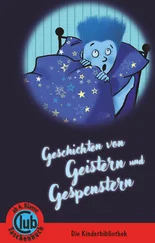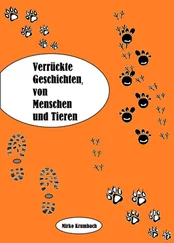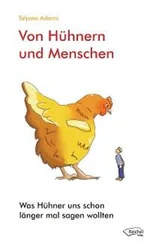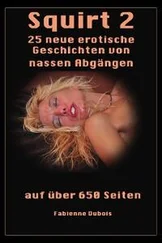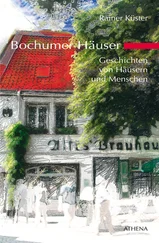Ich bin perplex. So etwas darf man doch nicht abreißen! Nicht hier bei uns in Bochum, wo die paar mehr oder weniger historischen Gebäude, die uns geblieben sind, an zwei Händen abzuzählen sind! Außerdem ist der Turm tatsächlich so etwas wie eine Landmarke, gibt der Bochumer Mitte ein Gesicht.
Wie es der Zufall will, habe ich am selben Abend Gelegenheit, Frau Dr. Ottilie Scholz, die Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum, die in der »Herrengesellschaft Kanone« einen Vortrag hält, zu fragen, ob an den kolportierten Plänen etwas dran sei. Sie weiß es – glaubwürdig – nicht, nimmt auch nicht an, dass es so sei. Das Postgebäude, ja, das könnte sein. Aber nicht Schlegel. Schließlich habe sie erst kürzlich veranlasst, dass abends das Wappen am Turm angestrahlt werde. Aber sie will noch einmal nachfragen, will sich drum kümmern, lässt sich meine Karte geben.
Eigentlich ist die Arbeit getan – bis auf eine Kleinigkeit. Klaus-Joachim Schlegel hatte mir bei unserer ersten Begegnung erzählt, dass Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ein Tunnel gebaut worden sei, der die Werksgelände dies- und jenseits des Westrings miteinander verband. Wie – ein Tunnel? Ich war sofort elektrisiert von der Annahme, dass man da unter Umständen noch einmal reingehen oder vielleicht auch trotz lädierter Bandscheibe reinkriechen könnte. Der Tunnel soll sieben Meter unter dem Westring gelegen haben und sei begehbar gewesen. Er sei bergmännisch vorgetrieben worden, heißt es. Davon müsste doch noch etwas zu sehen sein, vielleicht ein Loch mit einer Platte drauf oder eine Treppe, die vor eine Wand läuft. Herr Schlegel hat Menschen, die sich auskennen, befragt, und – er hat inzwischen etwas herausgekriegt.
Freitagmittag. Ich hole Klaus-Joachim Schlegel in der Uhlandstraße ab. Wir haben Glück, können sogar ganz in der Nähe unseres Ziels auf dem Westring parken, überqueren zu Fuß die Alleestraße. Vor dem Gebäude Westring 23 werfen wir einen Blick auf das große Schild einer Anwaltskanzlei. Einer der Anwälte heißt Michael Emde. Herr Schlegel hat mit ihm telefoniert, und Herr Emde hat uns erlaubt, dass wir mal in seinen Keller blicken dürfen. Er selbst wird allerdings nicht da sein, vielleicht ist er zu Tisch oder schon im wohlverdienten Wochenende. Als wir die Anwaltskanzlei betreten, werden wir gleichwohl erwartet; eine vorgewarnte Sekretärin geleitet uns zu einer Treppe aus Lichtgitterrost, die wir tief hinuntersteigen. Sieben Meter – ja, das könnte schon sein. Unten lagern tausende von Akten, eng in Regalen gestapelt. Um sich hier zurechtzufinden, dürfte man einen Kompass brauchen. Aber ich denke, die meisten der hier abgelegten Ordner wird wahrscheinlich nie wieder jemand hervorholen.
Wir sehen uns um und finden auch etwas. Auf dem Betonboden entdecken wir Spuren, die irgendwie auf die Träger von Förderbändern schließen lassen, die natürlich längst entfernt worden sind. Hier oder bis hierher könnten tatsächlich Bierkästen zur Verladerampe transportiert worden sein. Zur gegenüberliegenden Seite, also zum Westring hin, befindet sich eine Stahltür, die allerdings einen sehr verschlossenen Eindruck macht. Was dahinter ist, weiß niemand mehr. Herr Schlegel und ich sind uns sicher: Es ist der alte Verbindungstunnel.
Postskriptum: Es gibt ja doch noch ein Schlegelbier. »Schlegel Urtyp« heißt es und ist irgendwie ein Nostalgiebier, vor zehn Jahren ins Leben gerufen von zwei Schlegel-Freunden, die sich mit dem endgültigen Verlust ihrer Marke nicht abfinden wollten. Man bekommt es auch in Bochumer Getränkemärkten. Aber mit Bochum als Brauort hat es nichts mehr zu tun, selbst wenn die Rezeptur, was wir mal hoffen wollen, immer noch die alte ist. Übrigens war »Schlegel Urtyp« in den guten alten Zeiten von dem Verdikt, nach übermäßigem Genuss von Schlegelbier würden die heraldischen Hämmerchen des Hauses im Schädel des Genießers für den unvermeidlichen Kater sorgen, stets ausgenommen. Vielleicht eignet diese Qualität auch dem Nostalgie-Schlegel. Gebraut wird es, wie gesagt, nicht in Bochum, sondern seit seiner Wiederbelebung zunächst in Schwelm, heute in Iserlohn, wenn ich richtig informiert bin.
Ach, noch eins, ganz zum Schluss: Frau Oberbürgermeisterin wollte sich doch eigentlich melden, den angedrohten Abriss der Schlegelreste betreffend. Das hat sie bisher noch nicht getan und auch nicht tun lassen. Was soll man dazu sagen? Jammern nützt nichts, denn so eine Oberbürgermeisterin hat wirklich anderes zu tun.
[2012]
Im Kinderland der Kohlengräber
Diese Bochumer Straße ist noch immer ein Mythos, zumindest ein bescheidener. Sie wird es bleiben trotz mancher Umbenennungen, die auch Gutwillige zum Verzweifeln bringen können. Wenn am Samstag, dem 20. Oktober 2007, wieder Dreißigtausend, davon die meisten in banger Hoffnung, zum Spiel gegen die Bayern aus München ins Rewirpower-Stadion pilgern werden, dann liegt dieses stilistische Monstrum nach wie vor an der Castroper Straße. Das ist die Straße, nach der das Stadion einst benannt wurde, lange bevor es zum Ruhr-Stadion mutierte, und auf der nach dem Abpfiff eine zähe Autoschlange in beide Richtungen kriechen wird. Wenn man Glück hat, regeln ein paar Polizisten den Verkehrsfluss; Fußgänger, die sich zwischen den Autos hindurchquetschen wollen, leben an solchen Tagen gefährlich, riskieren alles Mögliche – je nach Ausgang des Spiels mit oder ohne Bierflasche in der Hand.
Fast unmerklich steigt die Straße stadtauswärts an. Das Nahziel ist die große Kreuzung von Harpener und Castroper Hellweg, wo sich die Ströme der Heimkehrer zum ersten Mal verästeln; auf dem Sheffield-Ring, der guten alten NS 7, können die Fußballfreunde aus dem Bochumer Süden bald wieder richtig aufs Gas treten. Aber noch sind wir nicht dort, so schnell geht das nach einem Spiel gegen die Bayern nicht. Wer angesichts des mühsamen Flusses der Kolonne aus dem Fenster sieht, gewahrt einen Ruhrpott, wie er im Buche steht. Rechts Häuserreihen, die schon bessere Tage gesehen haben, dahinter mehr oder weniger Industrielles, nicht unbedingt einladend. Links kann man durchaus wohnen, einkaufen, zur Schule oder in die Kirche gehen.
Genau dort, wo es für den Fußballfreund manchmal schon ein bisschen schneller vorwärtsgeht, steht ein bescheidenes, eher unscheinbares Haus mit der Nummer 233, gleich neben der Schule, nämlich da, wo von der Castroper Straße links die Wichernstraße abzweigt. Zwei Betonpfeiler blockieren von diesem Ende der Straße her die Einfahrt für Autofahrer. Am anderen Ende mündet sie in die Josephinenstraße. Von dort sind Autos willkommen. Die Straße ist benannt nach dem Hamburger Theologen Johann Hinrich Wichern, der damals, im einschlägigen Jahr 1848, auf dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg, nicht etwa den VfL Bochum, sondern die segensreiche Organisation der »Inneren Mission« gründete. Aber das hat mit dem Haus, von dem ich erzählen will, wirklich nichts zu tun. Man kann leicht daran vorbeifahren, ohne es wahrgenommen zu haben. Unscheinbar ist es auch deshalb, weil es vielen anderen Wohnhäusern in der unmittelbaren Umgebung und sonst im Revier so ähnlich ist, trotz mannigfaltiger Umbauten, die es immer wieder über sich hat ergehen lassen.
Im Frühjahr habe ich mir das Haus schon einmal angesehen, das sich aus zwei einigermaßen symmetrischen Hälften zusammensetzt. Hellgrau ist der Putz auf der linken, grau in grau auf der rechten Seite. Hier und da sind die Rollläden heruntergelassen. Mit Gardinen geschmückte Fenster an den Kopfenden signalisieren, dass es über der ersten Etage jeweils noch ein bewohnbares Dachgeschoss gibt. Zentral dem Doppelhaus vorgelagert ist ein kleiner, durch ein Satteldach geschützter Windfang, an dem die beiden Hälften des Hauses partizipieren und der sicherlich erst nach dem Kriege angelegt wurde. Zumindest auf der rechten Seite dient der Windfang als Eingangsportal. Eine blaue Plastikbank lehnt an seiner Wand und bringt etwas Farbe ins Bild.
Читать дальше