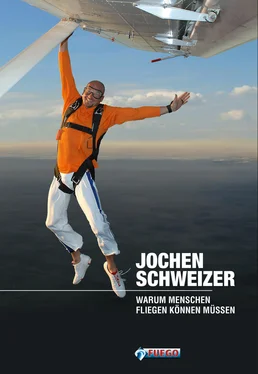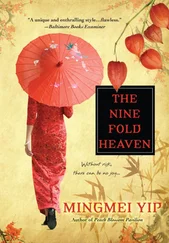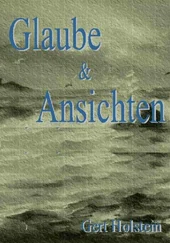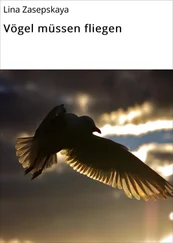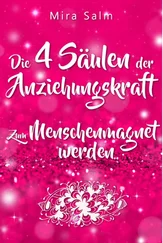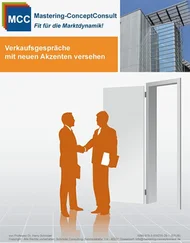Für vier Wochen wird das Tropicana meine Heimat – und ich bin der freieste Mensch der Welt. Nach dem reichlichen Abendessen und dem Geschichtenerzählen ziehe ich mich aus dem gediegenen Tropicana in das einfache Leben zurück, krieche in Zelt und Schlafsack. Tagsüber unternehme ich Touren entweder zu Fuß durch die Stadt oder mit dem Motorrad, manchmal sogar mit kleinem Gepäck und einer Übernachtung. Ich fahre ins Landesinnere von Togo, vor allem aber führen mich meine Ausflüge den Atlantik entlang nach Westen bis Ghana, nach Osten bis Benin. Ich erlebe Afrika so, wie ich es mir vorgestellt habe: singende Menschen in bunten Gewändern, unbeschwert wie große, fröhliche Kinder. Nicht ein einziges Mal fühle ich mich bedroht oder in Gefahr. Sondern immer wie einer von ihnen, wie ein weißer Afrikaner. Ein einfaches, aber lebendiges und zufriedenes Leben, das ich noch eine Weile leben kann. Ich zelte am Strand und gebe pro Tag umgerechnet vielleicht eine Mark aus.
Und wenn ich von meinen Ausflügen zurückfahre, ist es fast wie nach Hause kommen. Am Tropicana angelangt, lade ich ab, wasche mich, gehe ins Hotel und treffe dort viele bekannte Gesichter.
Und eines Tages den Mann, der einen entscheidenden Einfluss auf mein Leben haben wird: Rudolf Niehaus. Niehaus ist Inhaber einer in der Schweiz ansässigen, weltweit arbeitenden Spedition. Er ist ein hochgewachsener Mann mit einem hageren Gesicht und hellen, wachen Augen. Im Auftrag der GTZ – der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt, der offiziellen Entwicklungshilfegesellschaft der Bundesrepublik Deutschland – soll er Dutzende von Lastern in den Norden von Mali bringen. Dort, in Bourem, am nördlichsten Nigerbogen, hat die Entwicklungshilfe eine Phosphatmühle gebaut.
Ich bin mal wieder im Restaurant des Tropicana mit meinem kunstvoll geschichteten Fressteller unterwegs zu einem Tisch, als mich Rudolf Niehaus belustigt anschaut und dann anspricht: »Wenn du das jetzt hier auf der Stelle aufisst, dann halte ich dich die ganze Woche frei.« Ich überlege kurz: Steaks, Gemüse, Geschnetzeltes und Reis sind kein Problem. Aber das ganze Huhn, das war eigentlich für morgen Mittag gedacht. Doch eine Woche frei wohnen, in einem richtigen Zimmer? Also zögere ich nicht lange, setze mich zu Niehaus und seinen Freunden an den Tisch – und esse unter den staunenden und zweifelnden Blicken der Runde den Teller leer. Großer Applaus. Und Niehaus hält sein Versprechen: Für eine Woche ziehe ich mit Sack und Pack ins Tropicana ein. Wieder denke ich: was für ein Luxus. Und was ich wieder mal für ein Glück habe.
Während meiner Hotelwoche treffen Niehaus und ich uns häufig. Wir spielen Schach, erzählen uns gegenseitig Geschichten, schließlich kurven wir mit dem Motorrad durch die Gegend. Ich merke, dass Niehaus, ungeachtet seiner Verantwortung und Arbeit als Manager und Unternehmer, ein Abenteurer ist. Mehr als einmal schaut er verträumt auf die Maschine und sagt: »Junge, genieße das Leben, diese Reise, solange es geht.« Ich beherzige diesen Rat. Und es fällt mir nicht schwer. Vor allem nicht an den Sonntagen: Im Deutschen Seemannsheim von Lomé gibt’s für alle Seeleute, Afrikafahrer und alle Togolesen, die am Goethe-Institut Deutsch gelernt haben, die Höhepunkte deutscher Kultur: Filterkaffee, von der Frau des Pfarrers selbst gebackene Schwarzwälder Kirschtorte und danach einen deutschsprachigen Film. Heute, vielleicht nicht ganz zur Kirche passend: Leichen pflastern seinen Weg, ein Italowestern von Sergio Corbucci. In der Hauptrolle als Kopfgeldjäger und Schurke: Klaus Kinski. Nach Kaffee und Torte sitzen wir im Garten, und als die Dämmerung einsetzt, wird das Kino aufgebaut: der Projektor und zehn Meter davor ein fest gespanntes Laken. Film ab.
Eine Westernlandschaft im Winter, tief verschneit. Und ich sitze mittendrin, draußen, unter Palmen, bei 30 Grad, in Afrika. Klaus Kinski reitet durch den Tiefschnee: schwarze Klamotten, schwarzer Hut, schwarzes Pferd. Er jagt einen schwarzen Sklaven. Ich blicke mich um. Alles Schwarze. Grotesk. Der Sklave versteckt sich in der Scheune. Kinski geht ins Haus, zieht die Frau des Sklaven an den Haaren raus. Und ruft: »Komm raus, dann passiert ihr nichts.« Und der Schwarze kommt aus der Scheune, Kinski knallt ihn ab, packt die Leiche auf sein Pferd und sagt mit seiner leisen, fies klingenden Stimme: »Hoho, wer hätte das gedacht, ein Schwarzer ist doppelt so viel wert wie ein Weißer.« Um mich herum lachen alle. Afrika.
Ein paar Tage später bekommt mein Afrikabild einen Sprung, aber nur einen kleinen. Nachts liege ich im Schlafsack und höre ein Geräusch. Dann spüre ich ein Messer an meiner Kehle. »Money.« Meine Machete liegt unerreichbar unter meiner Liegematte. Ich gebe den unsichtbaren Männern, ich glaube, es sind zwei, meinen Brustbeutel. Und weg sind sie. Als ich aus dem Schlafsack raus bin, renne ich hinterher. Aber sie sind längst über alle Berge. Der Schock sitzt tief. Doch ich bin weder hektisch noch sauer. Ich sitze vor dem Zelt und überlege, was ich tun kann. Als es hell wird, findet man meinen Brustbeutel. Das Geld ist weg. Aber die Pässe und die anderen Papiere sind noch drin. Erleichterung. Und Afrika wird wieder so fröhlich, schön und geheimnisvoll wie vorher.
Am Abend gehe ich ins Tropicana und erzähle Rudolf Niehaus, was vorgefallen ist. Ich frage, ob er mir Geld leihen kann, damit ich nach Hause fahren kann. Er willigt ein – und setzt noch einen drauf: »Ich leihe dir das Geld. Aber du kannst dir auch welches verdienen: In zwei Wochen kommt das nächste Schiff mit Lastern für Niger an. Ich brauche eine Fotodokumentation der Überführung. Wenn du die lieferst, zahle ich dir 1.500 Franken.« Natürlich sage ich zu. Ich bin von seiner Großzügigkeit beeindruckt. 1.500 Franken sind weit mehr, als ich für die Heimreise brauche. Und ohne genau zu wissen, was mich erwartet, sicher auch ein sehr gutes Honorar für die Fotodokumentation. Der Deal ist perfekt. Niehaus fügt noch hinzu, dass er sich freuen würde, wenn ich auf meiner Rückreise bei ihm in Genf vorbeikäme. Ich verspreche es ihm.
Zwei Wochen später bin ich im Hafen von Lomé. Geleitet wird der Konvoi von zwei Feldwebeln der Bundeswehr. Sie geben den schwarzen Fahrern klare Anweisungen, aber ich merke, dass der Ton nicht der richtige ist. Ich würde es anders machen, würde versuchen, aus den einzelnen Fahrern ein Team zu bilden. Doch ich bin beherrscht genug, die Klappe zu halten. Dann gehen wir auf die Reise.
Ich lerne viel. Dass zum Beispiel die Passierscheine für die Grenze gefälscht werden. Gefälscht werden müssen, weil es gar keinen offiziellen Weg gibt, an diese Papiere zu kommen. Und dass jeder irgendwie daran verdient. Ich lerne, dass die vielen Polizeikontrollen nicht dem Schutz von irgendwem dienen, sondern dass die Schmiergelder fürs Weiterkommen das Haupteinkommen der Polizisten sind. Ich lerne, dass Afrika ganz anders ist, als ich dachte. Wieder ein Sprung in meinem Afrikabild. Und dieser Sprung wird mit jedem Tag, mit jedem Bakschisch, mit jeder Fälschung größer. Das ist nicht mehr mein Afrika. Und ich bin auch plötzlich nicht mehr der Sonnyboy auf dem Motorrad, sondern der reiche Weiße, der mit einem LKW-Konvoi unterwegs ist.
Obervolta. Wir kommen durch ein Dorf, halten an. Ich schaue mich um, mache Fotos. Menschen, Erwachsene, vor allem aber Kinder haben wässrige Blasen auf der Haut. Die Feldwebel klären mich auf: Die Krankheit wird durch Bakterien ausgelöst, das körpereigene Wasser sammelt sich in den Blasen, die Menschen trocknen aus. Und sterben. Antibiotika können helfen. Aber es gibt keine in den Krankenstationen.
In eine dieser Stationen schaue ich rein. Das Wort »Krankenstation« täuscht. Es gibt nichts, was nach Krankenhaus, Arztpraxis oder Medizin aussieht. Ein leerer Raum, wie eine ausgebrannte Garage mit Sperrmüll darin. Die Kranken liegen auf der Erde, vielleicht gerade noch eine Decke als Unterlage. Ein Sanitäter, erkennbar an der Rot-Kreuz-Binde am Ärmel. Das ist alles. Nicht einmal zu essen gibt es für die Kranken. Wer keine Familie oder Freunde hat, die ihn bekochen, verhungert.
Читать дальше