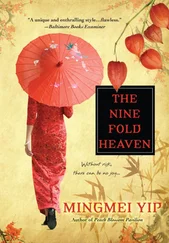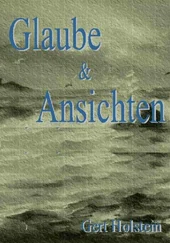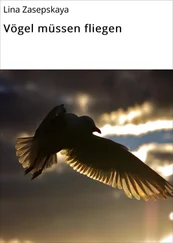8. August 1979. Es ist fast Mitternacht, und Caspars Vater kommt in die Garage, in der wir seit Stunden auf unseren selbst gebauten Motorradkoffern herumhämmern. 1,6 Millimeter dickes Stahlblech, gebogen und verschweißt. Genügend Platz für das Gepäck einer weiten Reise und stabil genug, auch mal einen Sturz zu verkraften. Caspars Vater kann unseren Enthusiasmus verstehen, aber jetzt beschweren sich die Nachbarn wegen des nächtlichen Lärms.
Wir legen den Hammer aus der Hand, fast dankbar dafür, dass wir nicht mehr weitermachen dürfen. Und es waren ohnehin die letzten noch zu erledigenden Umbauten. »Okay.«, sagen wir und folgen dem Vater ins Haus. Er kümmert sich um unsere Reiseapotheke, stattet uns mit allem aus, was wir auf unserer Reise hoffentlich nicht brauchen werden: meterweise Pflaster und Verbandmaterial, Tabletten gegen Grippe, Durchfall, Infektionen. Kochsalzlösung, starke Beruhigungs- und Schmerzmittel. Auch mit den schweren Geschützen, die man braucht, wenn man einen schwer verletzten Freund auf das eigene Motorrad binden muss, um ihn irgendwohin zu bringen in diesem Meer aus Sand und Steinen, das unser Ziel ist. Dann zieht er eine Spritze mit Kochsalzlösung auf und reicht sie mir, damit auch ich lerne, wie man Spritzen setzt. Ich drücke die Nadel in Caspars Hintern wie in ein dickes Steak – »pffff«, macht Caspar und revanchiert sich kurz darauf bei mir.
Ich fahre nach Hause in mein kleines Zimmer in der Landhausstraße. Carolin ist da – wir nehmen Abschied. Sie zeigt keine Angst, keine Sorge. Sie ist überzeugt, dass eine gute Kraft über mich wacht und ich unversehrt zurückkomme.
Wir sind schon drei Jahre zusammen. Unberührt sind wir uns begegnet, der wilde halbstarke Motorradfahrer und das schöne Mädchen aus gutem Hause. Nie werde ich vergessen, wie ich in meiner abgerissenen Lederjacke und mit langen Haaren von Carolins Mutter beim ersten Kennenlernen in den Salon gebeten wurde. Auf ein Glas Sherry und gepflegte Konversation. Ich war bei allen Göttern definitiv nicht der Typ Schwiegersohn, den sich die Familie für ihre Tochter gewünscht hätte. Aber wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie liegen, das mussten auch Carolins Eltern einsehen.
Auf meinem weiten Weg durch Afrika finde ich fast in jeder großen Stadt auf der Poststation einen Brief von ihr vor. Jochen Schweizer, Niamey, Niger, Poste Restante. Sie weiß, welche Route wir nehmen wollen, und kennt sogar die Alternativen. Ohne viele Worte hat sie mich gehen lassen – und ist in Gedanken doch dabei. Ich danke es ihr, indem ich keinen ihrer Briefe unbeantwortet lasse, und so folgt sie mit einiger zeitlicher Verschiebung unserer späteren Route.
Der nächste Tag. Es ist fünf Uhr früh, am Horizont zeigt sich eine zarte Morgenröte, die Luft ist klar und kalt. Nach Monaten der Vorbereitung beginnt unser großes Abenteuer. Ein rührender Abschied von Caspars Eltern, »uffbasse«, sagt Caspars Vater auf Badisch, nimmt mich in den Arm und drückt auch mich. Dann treten wir die Motoren an. Unsere Maschinen sehen abenteuerlich aus, die riesigen Stahlblechkoffer an den Seiten, auf dem hinteren Teil der Sitzbänke türmt sich das Gepäck fast einen Meter hoch. Und obendrauf noch jeweils zwei Ersatzreifen. Wir rollen die Ludolf-Krehl-Straße hinunter, fahren durch die noch schlafende Stadt direkt auf die Autobahn und steuern den nächstgelegenen Grenzübergang nach Frankreich an, um uns keinen Ärger mit der Polizei wegen unserer überladenen Motorräder einzufangen.
Wir bummeln durch Frankreich, selten schneller als 100 km/h. Erstens haben wir Zeit, zweitens wollen wir Motoren und Material schonen. Die XT hat viel Kraft in niedrigen Drehzahlen, das ist gut. Dafür vibriert ihr Einzylinder aber gern die eine oder andere Halterung ab.
Wir fahren. Nichts weiter. Einfach nur fahren. Ich hänge meinen Gedanken nach, blicke zurück. Das Abitur am Wirtschaftsgymnasium. Für mich war es eine gewaltige Hürde, die sich über mehr als ein Jahr vor mir aufgetürmt hatte. Und die ich dann aber, zu meiner großen Überraschung, irgendwie genommen habe. Und danach? Eine Zeit der Leere und Orientierungslosigkeit, ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und jetzt der Ausblick auf die kommenden Monate: vor mir die Straße, Frankreich, Spanien, Afrika.
Ich fühle mich so unendlich frei. Kein Plan, kein Ziel, keine Ahnung, was ich mal machen werde. Jetzt fahre ich erst mal. Einfach nur fahren, die Kilometer fressen. Es ist warm, die Maschinen laufen ruhig und regelmäßig. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, sind unabhängig. Dazu die Lust auf Abenteuer und bei mir das Gefühl, gar nicht zu wissen, wann ich wieder umdrehen, zurückfahren muss. Ich genieße diese Ungewissheit, spüre, wie gut es mir tut, meinem Fernweh nachgeben zu können. So müssen sich früher die Seeleute gefühlt haben, als sie mit ihren voll ausgerüsteten Schiffen zu fernen, unbekannten Küsten aufbrachen und nicht wussten, ob und wann sie in die Heimat zurückkehren würden.
Wenn ich nicht solchen Gedanken nachhänge, singe ich in meinen Helm. Meistens alte Stones-Titel: »Under my thumb, Wild horses.« Auch Jimi Hendrix kommt gut. »All along the watchtower, Hey Joe.«
Bei Sète in Südfrankreich stoßen wir aufs Mittelmeer. Wir biegen rechts ab, folgen der Straße entlang dem Meer, bis wir außerhalb der Ortschaft auf einen leeren, unberührten Strandabschnitt treffen. Sand wie in der Wüste, denke ich, nehme Anlauf und steche schräg von der Straße aus mit 80 km/h in spitzem Winkel in den Strandabschnitt. Aber das schwere Motorrad schaukelt sich schon nach ein paar Metern gewaltig auf, ich gehe vom Gas (Fehler Nr. 1) und versuche mit den Füßen am Boden Halt zu finden (Fehler Nr. 2). Der Strand kennt keine Gnade, und in hohem Bogen segle ich über den Lenker. Ich überschlage mich ein paar Mal, rolle aus und stehe unverletzt auf meinen Füßen – verdutzt und mit viel Sorge um mein Motorrad. Wir sind doch erst 1.000 Kilometer gefahren und noch so viele mehr liegen noch vor uns. Das größere Problem hat Caspar. Er ist schwer deprimiert. 3.000 Kilometer breit ist alleine der Sandstreifen der Sahara, den wir durchqueren müssen, um auf den Atlantik zu treffen – und ich schaffe nicht mal die ersten 150 Meter . . .
Wir reden nichts, während wir mein Moped wieder zusammenbauen und zurück zur Straße wuchten.
In Algeciras in Südspanien haben wir noch etwas Zeit, bis die Fähre nach Marokko fährt. Wir besuchen Carolins Tante Ursula in einem noblen Hotel bei Málaga, das sie seit einem halben Leben leitet. Hier habe ich schon vor einem Jahr auf meiner Alleinfahrt nach Marokko Station gemacht. Damals war ich ebenfalls von Tante Ursula zu einem edlen Dinner eingeladen worden. Die Gäste schauten irritiert, als die Dame in Begleitung eines jugendlichen Rockers in definitiv unpassender Bekleidung den Speisesaal betrat. Ich war ziemlich unsicher; noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich einen so erlesenen Speisesaal betreten. Ich wusste, wie man ein Kajak im Wildwasser bewegt, wo beim Hinterrad meines Motorrades bei maximaler Schräglage die Rutschgrenze liegt und wie man seine Fäuste gebraucht – aber so eine Ansammlung von Besteck rechts und links des übergroßen Tellers vor mir hatte ich noch nie gesehen.
Ursula machte Konversation, sie versuchte herauszufinden, an was für einen Typen ihre geliebte Nichte ihr Herz verloren hatte. Ich kämpfte derweil mit einer Languste, die auf keinen Fall auf meinem Teller bleiben wollte. Fast war es so, als wolle sie dringend zurück ins Meer springen. Ursula betrachtete belustigt meine Versuche und half mir dann beherzt und unprätentiös, die Aufgabe zu meistern. Ich war ganz schön ins Schwitzen gekommen und hatte einen Riesendurst. Genau in dem Moment kam der Kellner mit hochgezogenen Augenbrauen an den Tisch gewedelt und brachte eine riesige Kristallschale voll Wasser, auf dem ein paar exotische Blüten schwammen. Geformt wie eine Champagnerschale, aber fünfmal so groß. Für die Finger, wie ich später erfuhr. Das wusste ich aber nicht, setzte an und trank die Schale mit einem gewaltigen Zug aus. Gerade schaffte ich es noch, ein zufriedenes Rülpsen zu unterdrücken, als ich in Ursulas versteinertes Gesicht blickte. Uuups, dachte ich, habe ich schon wieder was falsch gemacht?, und schaute Ursula mit treuen Augen an, als sich ihr Gesicht erhellte und sie in ein erfrischendes Lachen ausbrach. »Un mas«, beschied sie dem Kellner, der ungläubig schaute, und scheuchte ihn mit einer Handbewegung weg wie ein lästiges Insekt.
Читать дальше